Proseminar:
Sozialpsychologie
Leiterin:
Mag. Dr.
Helga Elisabeth Proseminar: Sozialpsychologie
L
Leiter
Proseminar: Sozialpsychologie
Leiterin:
Mag. Dr. Helga Elisabeth Schachinger
SS 2007
ALTRUISMUS
Höbart Andreas
Kratochwil Claudia
Oberzill Pascal
Schiefermaier Melanie
Stadler Johannes
Weidhofer Anna
Inhaltsverzeichnis
3
1. Einleitung
1.1 Definitionen.................................................................................................................. 3
1.11
Prosoziales Verhalten...................................................................................... 3
1.12 Helfen................................................................................................................. 3
1.13 Altruismus.......................................................................................................... 4
1.2 Theorien hilfreichen
Verhaltens.................................................................................. 4
5
2. Wann
helfen Menschen?
2.1 Cost-reward framework ............................................................................................. 5
2.2 Decision model of intervention von Darley
und Latane (1970)......................... 8
2.3 Wann helfen Menschen
nicht?........................................................................ 11
2.31 Theorien der Hemmung der Hilfsbereitschaft........................................ 11
2.311 Theorie der Diffusion der Verantwortung....................................... 12
2.312 Theorie der pluralistischen Ignoranz.............................................. 12
2.313 Theorie der Bewertungsangst.......................................................... 13
13
3. Warum helfen Menschen?
3.1 Gelernte
Hilfsbereitschaft............................................................................... 13
3.2 Erregung und
Affekt........................................................................................ 15
3.3 Empathie.................................................................................................................... 17
3.31 Empathie und Emotion................................................................................. 17
3.32 Empathy – altruism hypothesis .................................................................. 18
3.33 Empathy – specific punishment.................................................................. 19
3.34 Empathy – specific reward .......................................................................... 20
3.35
Empathie als Ergebnis der Sozialisation................................................... 21
3.36 Dispositionale Empathie als Erklärung hilfreichen Verhaltens.............. 23
3.4 Altruistisches Motivsystem...................................................................................... 23
3.5 Negative state relief model...................................................................................... 28
3.6 Normative Theorien.................................................................................................. 29
3.61 Soziale Normen und persönliche Standards........................................... 30
3.62
Soziale Verantwortung................................................................................. 31
3.63
Persönliche Normen, Ziele und Selbst-Konzept..................................... 31
3.7 Collectivism: benefiting another to benefit a
group.............................................. 32
3.71 Social dilemmas........................................................................................ 32
3.72
Collectivism und egoistische Motive...................................................... 33
3.8 Fairness.................................................................................................................... 34
3.9 Biologische Motive für das Helfen und
Altruismus................................................ 35
4. Wer hilft? 37
4.1 Unterschiede in der Veranlagung............................................................................ 37
4.11
Demographische Aspekte....................................................................... 38
4.12 Geschlechterunterschied.......................................................................... 39
4.13
Motive und Hilfestellung........................................................................... 40
4.14 Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und
Altruismus................... 41
4.2 Persönlichkeit und Helfen: Kritik.............................................................................. 43
44
5. Anwendungsgebiete
5.1 Zivilcourage................................................................................................................ 44
5.2 Theorie der intrinsischen Motivation und
freiwilliges Arbeitsengagement.......... 45
5.3 Attributionstheorie und prosoziales
Verhalten in der Schule................................ 45
46
6. Fazit
47
7. Literaturverzeichnis
1.
Einleitung
Die folgende Arbeit soll einen Überblick über
den Begriff des "Altruismus“ aus einer psychologisch-wissenschaftlichen
Perspektive bieten. Beginnend mit der Definition einiger, wichtiger Begriffe
erläutert diese Arbeit folgende Abbildung:
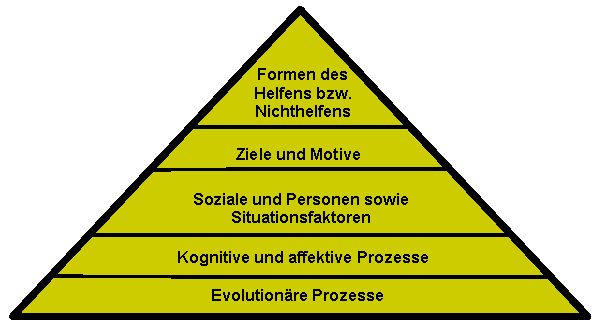
Abbildung 1.1
1.1
Definitionen
1.11 Prosoziales Verhalten
„Prosocial behavior
represents a broad category of actions that are defined by society as generally
beneficial to other people and to the ongoing political system“ (Piliavin,
Dovidio, Gaertner, & Clark, 1981, p. 4.)
Prosoziales Verhalten ist der Überbegriff einer Kategorie von Verhalten,
dessen Ausführung der Allgemeinheit nützen soll. Es gibt verschiedene Arten von
prosozialem Verhalten: Helfen, Teilen, Kooperation, Beruhigung, Spenden.
1.12 Helfen
Absichtlich herbeigeführte Handlung, deren Ergebnis einer anderen Person
zugute kommt. Man hat Versuche durchgeführt, um die grundlegenden
Charakteristika von Helfen zu erläutern, und ist zum Ergebnis gekommen, dass
mehrere „Schlüsseldimensionen“ involviert sind, z.B. welche Art von
Hilfe wird benötigt, potentielle Konsequenzen für Helfen bzw. Nichthelfen (Mc
Guire, 1994; Pearce & Amato, 1980; Shotland & Hutson, 1979).
Helfen ist mit dem Ausführen einer Handlung gleichzusetzen.
1.13 Altruismus
Beim Altruismus ist die grundlegende Motivation des Verhaltens
ausschlaggebend. Klassische Definitionen enthalten die innerliche Motivation,
als Eigenschaft für altruistisches Helfen. Altruismus ist eine spezielle Art
von Helfen, die nicht darauf abzielt eine Belohnung für ein helfendes Verhalten
zu erhalten (Macauly & Berkowitz, 1970), obwohl Kosten mit der
Hilfestellung verbunden sind (Krebs, 1982; Wispe, 1978).
Batson (1991, p. 6): Altruismus bezieht sich nicht auf prosoziale
Handlungen an sich, aber auf das grundlegenden Ziel der Handlung: „Altruismus
hat zum Ziel das Wohl anderer zu steigern“. Der Gegensatz zu Egoismus, der
darauf abzielt, das eigene Wohl zu steigern.
1.2
Theorien hilfreichen Verhaltens
Hilfreiches Verhalten ist universell
verbreitet und verbindet Menschen überall auf der Welt. Gleichzeitig ist
festzustellen, dass unter Hilfeleistung eine Vielzahl von Handlungen
zusammengefasst wird. Hilfreiches Verhalten ist also auf ein Bündel von
Faktoren zurückzuführen. Hilfreiches Verhalten lässt sich auf mehreren Ebenen
der Analyse betrachten:
- interpersonelle
Ebene
- normative
Ebene
- Persönlichkeitsebene
Im folgenden wird davon ausgegangen, dass
prosoziales Verhalten ein einheitliches Phänomen ist, das sich in vielen
unterschiedlichen Formen konkretisiert. Diese Annahme kommt in den folgenden
Definitionen zum Ausdruck (vgl. Bierhoff, 1990, S.9)
„Altruistisches
oder prosoziales Verhalten eines Akteurs ist dann gegeben, wenn er/sie die
Absicht hat, einer konkreten Person eine Wohltat zu erweisen und wenn der
Akteur freiwillig handelt (und nicht im Rahmen der Aufgaben, die sich durch
dienstliche Rollenverpflichtung ergeben).“ Demgegenüber umfasst helfendes Verhalten zusätzlich, wenn
Hilfe durch Personen geleistet wird, die ihren Beruf ausüben (z.B.
Rettungsassistenten). „Von helfendem
Verhalten wird also dann gesprochen, wenn die Absicht besteht, einer konkreten
Person eine Wohltat zu erweisen.“ (vgl. Bierhoff, 1990, p.9)
Ein zentrales Merkmal des prosozialen und
altruistischen Verhaltens ist die Freiwilligkeit. Es handelt sich um ein
Handlungsmuster, das stärker intrinsisch als extrinsisch motiviert ist, wenn
auch subjektive Einschätzungen von Kosten und Belohnungen eine Rolle spielen.
Schon auf den ersten Blick ist die
Hilfeleistung, die im Wechseln von Kleingeld besteht und die, die in der
Rettung eines Ertrinkenden besteht, sehr unterschiedlich. Wechseln von
Kleingeld ist eine Alltagsentscheidung, während im anderen Fall eine
schwerwiegende Entscheidung zugrunde liegt, die im individuellen Erleben von
Helfer und Empfänger eine sehr große Bedeutung hat.
Welche sind die Gemeinsamkeiten und was
sind die Unterscheide von beiden Formen der Hilfeleistung?
Gemeinsam haben beide, dass die
individuellen Pläne der Helfer bei der Hilfeleistung selbst, von
untergeordneter Bedeutung sind. Es dominieren soziale Einflüsse, die sozusagen
der Person, eine von ihr nicht geplante Handlungsweise aufzwingt. Der
Unterscheid der beiden Hilfeleistungen besteht darin, dass der gegenüber einem
Ertrinkenden zu leistende Einsatz und die Opferbereitschaft einem Helfer mehr
Kraft abverlangt als jene im alltäglichen Bereich.
Dies waren Beispiele von Hilfeleistung
ohne Vorplanung. Ein gutes Beispiel für die geplante Hilfe ist die
Unterstützung eines Freundes während des Umzugs, nachdem dieser in der
Vergangenheit ebenfalls bei gleicher Gelegenheit unterstützend tätig war. In
diesem Fall kommt das Prinzip der Gegenseitigkeit zum Ausdruck.
Gegenseitigkeit könnte eine biologische
Grundlage haben (Trivers, 1971), wenn man davon ausgeht, dass die Tat des
Helfers geringe Kosten erzeugt, während die Belohnung für den Empfänger dabei
groß ist.
Ein anderer Fall von planvoller Hilfeleistung ist gegeben, wenn eine
Person aus dem Gefühl der sozialen Verantwortung heraus anderen Menschen hilft,
z.B. verfolgte Juden während der Nazizeit versteckt.
In den Beispielen haben wir es mit normativ beeinflussten Handlungen zu tun,
wobei in den beiden Fällen die Norm der Gegenseitigkeit zu Grunde gelegt wird,
während in dem anderen Fall die Norm der sozialen Verantwortung zur Grundlage
der Handlungsplanung wird.
2. Wann helfen Menschen?
Viele frühere Studien zur Frage „Wann helfen Menschen?“ waren auf keine
Notsituationen fokussiert und daraus hat sich gezeigt, dass das Eingreifen von
äußerlichen Faktoren (Normen der Gegenseitigkeit) und innerlichen Einflüssen
(Notwendigkeit für soziale Zustimmung, Anerkennung) geleitet wird. In den 60-er
Jahren wurde in den Nachrichten ein dramatischer Unfall gezeigt, bei dem die
Unfallzeugen versagten, indem sie nicht eingriffen um Leben zu retten.
2.1 Cost-reward framework
Die Kosten-Nutzen-Analyse von Helfen zeigt einen wirtschaftlichen Zug
des menschlichen Verhaltens. Menschen sind motiviert ihre Nutzen zu maximieren
und gleichzeitig die Kosten gering zu halten (Piliavin et al., 1981). Menschen
sind rationell und hauptsächlich mit Eigeninteresse beschäftigt. In einer
möglichen Hilfesituation analysiert die Person zuerst die möglichen Umstände,
d.h. sie wiegt mögliche Kosten und Nutzen ab und dann entscheidet sie sich für
das persönlich beste Ergebnis. Es gibt 2 Kategorien von Kosten und Nutzen:
- für Helfen und
- für Nichthelfen.
Kosten fürs Helfen können beinhalten:
Anstrengung und Zeitaufwand, Gefahr, sowie Verschiebung und Unterbrechung einer
ausführenden Tätigkeit.
Kosten für Nichthilfe können sein:
Schuldgefühle, Scham und öffentlicher Tadel.
Nutzen für Helfen sind: Geld, Berühmtheit,
Selbstlob, Vermeidung von Schuld, Dank des Opfers sowie die innerliche Freude
geholfen zu haben.
Die gegenwärtige Forschung stimmt mit dem zentralen Grundsatz des
Kosten-Nutzens-Ansatzes überein. Situationsfaktoren, die die Nettokosten für
Helfen mindern oder die Kosten für Nichthelfen erhöhen, führen zum Eingreifen
(Dovidio et al., 1991).
Die negativen Werte schließen sich den Kosten an, während die positiven
Werte an die Belohnung anknüpfen. Diese werden beeinflusst von den Merkmalen
der in Not geratenen Person; die Art der Beziehung zwischen Opfer und Helfer
und der mögliche Nutzen; und den persönlichen Kennzeichen der möglichen
Entlohnung.
Ein Beispiel: Die Kosten für Nichthelfen sind geringer, wenn das Opfer
selbst für die Misere verantwortlich gemacht werden kann, in der sie steckt.
Kosten für Nichthelfen sind höher, wenn das Opfer für die Situation nicht
verantwortlich gemacht werden kann, weil sie diese nicht kontrollieren kann
(Otten et al., 1988). Zwischenmenschliche Anziehung erhöhen die
Hilfsbereitschaft, da der mögliche Nutzen mit der Möglichkeit eine Freundschaft
zu schließen steigt. Kosten für Nichthelfen steigen auch bei positiver Haltung
gegenüber dem Opfer und aufkommenden Gefühlen (Schuldgefühl). Hierbei fallen
auch die Kosten für Helfen oder es steigt der Nutzen. Bei Menschen, die sich
eine Freundschaft mit jemanden wünschen, steigert dies die Hilfsbereitschaft.
Im Gegensatz dazu, reagieren jene Personen, die sich keine Freundschaft
wünschen, mit negativen Affekten, wenn Hilfe verlangt wird (Williamson &
Clark, 1992). Positive Assoziationen liegen auch bei Kleidungsstil,
Nationalität, Persönlichkeit, Einstellung und gemeinsame Gruppenzugehörigkeit
oder soziale Identität vor (Dovidio, 1984; Dovidio et als., 1997). Es wird eher
Gruppenmitgliedern der eigenen Gruppe geholfen, als Mitgliedern anderer
Gruppen. Dies gilt kulturübergreifend und der Effekt ist bei kollektivistischen
Staaten (China, Japan) größer als in individualistischen Kulturen (USA; vgl.
Moghaddam, Tayler, & Wright, 1993). Ein Grund dafür ist, dass Ähnlichkeiten
mit dem Opfer das Eingreifen unterstützen, denn die Kosten für Nichthilfe
steigen und gleichzeitig wird die Belohnung für Helfen erhöht (Williamson &
Clark, 1992).
Menschen, die sich von einem selbst unterscheiden, werden als
unberechenbar wahrgenommen, manchmal sogar gefürchtet. Auch ihre andersartigen
Werte und ihr andersartiger Glaube wirkt sich negativ auf Hilfeleistungen aus.
Kosten für Nichthelfen sind hierbei geringer.
Positive Einstellungen unterstützen Helfen, während negative
Einstellungen die Bereitschaft zu helfen reduzieren können.
Stigmatisierte Personen erhalten nicht so häufig Hilfe wie nicht
stigmatisierte (Edelmann, Evans, Pegg, & Tremain, 1983; Walton et al.,
1988). Negative soziale Einstellungen, wie z. B. Rassenvorurteile, werden
sanktioniert und deshalb ist die Gliederung in ethnischen Gruppierungen und
deren Hilfeleistungen sehr komplex (Gaertner & Dovidio, 1986).
Untersuchungen zeigen, dass weiße Menschen afroamerikanischen Menschen
nicht so gerne helfen, wie weißen Menschen. Andere Studien wiederum haben aber
ergeben, dass Weiße den Afro-Amerikanern lieber helfen als Weißen.
Gaertner und Divido führen eine Arbeit an, welche versucht, die Gründe dieser Gegensetzlichkeiten zu
erklären. Diskriminierung verletzt soziale Normen und kann auch das
Selbstbild („ich bin fair“) stören. Es hat mit Kosten zu tun, wenn man andere
diskriminiert. Eine Konsequenz dieser Kosten kann sein, dass Weiße
Afro-Amerikanern öfter helfen als Weißen (Dutton & Lennox, 1974), denn es
könnte als Neigung interpretiert werden.
Man hilft eher, wenn die Kosten durch den Nutzen
gedeckt werden. Diese Auswertung ist subjektiv determiniert, dass heißt es gibt
individuelle Variationen in ähnlichen Situationen. Kosten und Nutzen fallen
notwendigerweise nicht immer gleichbedeutend aus: Kosten sind normalerweise
schwergewichtiger (Dovidio et al., 1991).
2.2 Decision model of
intervention von Darley und Latane (1970)
Es gibt eine Serie von vorausgehenden Entscheidungen, bevor man als
Zuseher eingreift. Das Entscheidungsmodell wurde entwickelt, um zu verstehen
wie Menschen in Notsituationen, die Hilfe erfordern, handeln. Aspekte dieses
Modells können in vielen anderen Situationen angewendet werden. Zum Beispiel:
Wann spendet jemand einem Verwandten eine Niere (Borgida, Conner, & Manteufel,
1992; Rabow, Newcomb, Monto, & Hernandez, 1990)?
Laut Latane und Darley (1970) gibt es 5 Schritte, die vor Eingreifen
abgewogen werden. Alle diese Schritte müssen mit einem Ja beantwortet werden,
um auch wirklich einzugreifen. Ein einzelnes Nein führt zum Nichteingreifen.
Die 5 Schritte:
- Man muss wahrnehmen, dass etwas nicht stimmt.
- Die Situation muss so verstanden werden, dass ein Eingreifen
erforderlich ist.
- Die Entscheidung wird getroffen, selbst Verantwortung zu
übernehmen.
- Welche Art von Hilfe wird benötigt?
- Man entscheidet sich die nötige Hilfe zu leisten.
JA
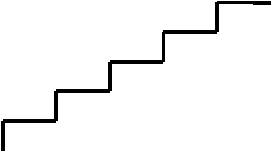
JA 5
JA 4
JA 3
Entscheidung:
Bejahung
JA 2
Folge:
Es wird eingegriffen.
1
Abbildung 2.1
![]()
![]()
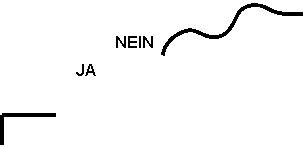
3
JA 2
Entscheidung: Verneinung
Folge: Es wird nicht eingegriffen.
1
Abbildung 2.2
Ad Schritt 1:
Zuseher erkennen eine Notsituation, wenn diese ihre Aufmerksamkeit auf
sich zieht und klar zu verstehen ist. Aspekte der physikalischen Umgebung
(Geräusche; Mathews & Canon, 1975) und das soziale Umfeld
(Populationsdichte; Levine, Martinez, Brase, & Sorenson, 1994)
beeinflussen, ob Menschen Notsituationen erkennen und daraufhin helfen.
Verschiedene Studien in mehreren Ländern haben ergeben, dass Menschen in
Städten nicht so oft helfen, wie Menschen in ländlichen Gegenden (Hedge &
Yousif, 1992; Yousif & Korte, 1995). Erklärungen können sein, dass Menschen
in Städten zu viele Stimuli zu bewältigen haben (Milgram, 1970) und sich mehr auf eigene relevante Abläufe konzentrieren.
Fremde und deren Notsituationen werden nicht beachtet.
Weiters hängt es von der Stimmung, vorübergehenden Gefühlen und
Zuständen ab, ob Notsituationen wahrgenommen werden oder nicht. Bei guter Laune
(Salovey, Mayer, & Rosenhan, 1991) wird geholfen und die Aufmerksamkeit für
andere steigt (Mc Millen, Sanders, & Solomon, 1977). Eine angenehme
Umgebung (z.B. Duft) kann durchaus, durch die Steigerung der Laune, den Hang
zur Hilfsbereitschaft fördern (Baron, 1997). Umgebungsbedingter Stress hat
üblicherweise einen negativen Einfluss auf die Stimmung des Menschen (Bell,
Fisher, Baum, & Greene, 1996).
Ad Schritt 2:
Der Haupteinfluss, ob eine Notsituation vorliegt oder nicht, ist das
Ereignis selbst. Unbeteiligte Zuseher sind eher geneigt zu helfen, wenn die
notleidende Person ihre Not durch z.B. einen Schrei direkt ausdrückt, als wenn
das Opfer nicht schreit (Piliavin et al., 1981). Soziale Umgebung beeinflusst
auch das Erkennen einer Notsituation.
Wenn Zuseher ein Ereignis zwar wahrnehmen, jedoch nicht erkennen, dass es sich
um eine Notsituation handelt, können andere Zeugen die Beurteilung der
Situation beeinflussen. Unruhe und Alarm kann die Bereitschaft zu helfen
fördern.
Ad Schritt 3:
Zuseher müssen sich klarmachen wer verantwortlich für das Helfen ist.
Entscheidung ist offensichtlich, wenn eine Person dafür prädestiniert ist.
Aufteilung der Verantwortlichkeit liegt dann vor, wenn Leute glauben, dass
andere auch Zeugen der Notsituation sind und helfen können. Der Gedanke, dass
andere helfen werden, führt dazu die eigene Verantwortlichkeit für das
Eingreifen abzugeben, denn die Unterstützung ist nicht länger begründet (Darley
& Latane, 1968; Otten, Penner, & Waugh, 1988).
Eine Aufteilung der Verantwortung tritt nicht ein, wenn bei anderen die
Unfähigkeit zu helfen gegeben ist (Korte, 1969). Wenn persönliche Gefahr droht
oder andere Zeugen besser geeignet sind um zu helfen oder wenn es Normen gibt,
die es erlauben oder unterstützen, dann tritt wieder die Aufteilung der
Verantwortung auf (Dovidio, Piliavin, Gaertner, Schroeder, & Clark, 1991;
Piliavin et al., 1981).
Die ersten 3 Schritte wurden empirisch untersucht und unterstützt.
Schritt 4 und 5, welche Art von Hilfe wird benötigt und die Entscheidung, die
nötige Hilfe zu leisten, wurden noch nicht wirklich untersucht. Dennoch, bisher
geleistete Arbeit unterstützt die Annahmen. Menschen mit Erste-Hilfe Kurs
bieten erfolgreichere medizinische Hilfe
an, als Menschen ohne relevantes Training (Shotland & Heinold, 1985).
Latane´s und Darley´s Entscheidungsmodell des
Eingreifens stellt eine nützliche Arbeit zum Verständnis dar, wann jemand hilft
bzw. nicht hilft. Das Modell ermöglicht
eine genauere Analyse wie die Merkmale einer Situation und eines Opfers die
Hilfeleistung beeinflussen.
2.3 Wann helfen Menschen
nicht?
2.31
Theorien der Hemmung der Hilfsbereitschaft
1964 wurde die New Yorkerin Kitty
Genovese von einem Mann ermordet.
38 Nachbarn waren Zeugen, als sie auf ihrem Parkplatz überfallen wurde. Die
Ausübung des Verbrechens dauerte über eine halbe Stunde. Als die Polizei
schließlich verständigt wurde und daraufhin sehr schnell am Tatort erschien,
konnte sie nur noch den Tod des Opfers feststellen, welches schließlich von dem
Angreifer erstochen worden war. Der Vorfall hat eine Diskussion über die
Ursachen von unterlassener Hilfeleistung ausgelöst.
Es gibt 3 theoretische Ansätze zur
Aufklärung von unterlassener Hilfeleistung:
- Theorie der Diffusion der Verantwortung unter mehreren Zuschauern,
- Theorie der pluralistischen Ignoranz aufgrund negativer Modelleffekte und
- Theorie der Bewertungsangst in öffentlichen Situationen.
In der Erforschung von hilfreichem
Verhalten stand lange Zeit die experimentelle Untersuchungsmethode im
Vordergrund. Der Vorteil dabei ist, dass diese Versuche darin bestehen, dass
die Prozesse, die zum Eingreifen führen, genau differenziert werden können.
2.311
Theorie der Diffusion der Verantwortung
Mit Diffusion der Verantwortung meint
man, wenn sich mehrere Zeugen eines Unglücks die Verantwortung teilen, sodass
jeder der Zeugen für sich selbst weniger Verantwortung empfindet. Steigerung
der Diffusion in solchen Notsituation sind
z.B. wenn noch ein Mediziner anwesend ist, auf den man die ganze Verantwortung
schieben kann. Die Verantwortung in solchen Notsituationen wird gerne auf
andere abgeschoben, besonders wenn in solchen Fällen medizinische Kenntnisse
und persönliches Engagement verlangt werden und der Stress dieser
Helfersituation vermindert wird.
Pacer et al. (1979) geht davon aus, dass
eine Tendenz besteht, Situationen zu vermeiden, in denen Hilfe angemessen sein
könnte. Diese Hypothese wurde dadurch belegt, dass bei Sammelaktionen (z.B.
UNICEF) erfasst wurde, in welchem Abstand die Personen an dem Sammeltisch
vorbeigingen. Diese Distanz wurde mit dem Abstand verglichen, der zu dem Tisch
gehalten wurde, wenn keine Sammlung durchgeführt wurde. Die Ergebnisse sind
eindeutig: Passanten vermeiden es, in die Nähe einer Sammlung zu kommen. Der
Abstand zum Tisch ist geringer, wenn keine Sammlung stattfindet, hingegen
größer beim Stattfinden einer Sammlung.
2.312
Theorie der pluralistischen Ignoranz
Eine typische Reaktion auf eine
Unfallsituation ist, dass die Beobachter überrascht und entsetzt sind, jedoch
mit einem hohen Maß an Hilfsbereitschaft reagieren. Wenn jedoch ein Beobachter
seine Reaktion auf den Unfall unterdrückt und mit Zurückhaltung reagiert,
entsteht der negative Vorbildeffekt, der auch als pluralistische Ignoranz
bezeichnet wird. Dieser Begriff wurde ursprünglich von Allport (1924) geprägt
und bezeichnet die Fehlinterpretation des Verhaltens anderer Menschen, die ihre
wahre Meinung zum Ausdruck bringen und so zu Irrtümern und Fehlverhalten
beitragen. Durch diese passive Reaktion wird anderen Zuschauern signalisiert,
dass nichts Besonderes vorgefallen ist und daher kein Eingreifen erforderlich
ist. Dadurch entsteht eine Bereitschaft, die Notlage der Opfer zu ignorieren.
2.313
Theorie der Bewertungsangst
Die Forschung hat auch gezeigt, dass die
Bereitschaft zum Eingreifen reduziert wird, wenn die Helfer glauben, sie
könnten sich durch ihr Eingreifen lächerlich machen. Das passiert wenn die
Menschen keine Vorerfahrung mit einer entsprechenden Notsituation haben, meist
ist es auch die erste Konfrontation mit einem schweren Unfall. Durch diese
Unsicherheit entsteht die Angst sich zu blamieren.
Piliavin (1969) ging der Frage auf den
Grund: Wie verhält sich ein Passant wenn ein Notfall unmittelbar neben ihm
stattfindet? Die Untersuchung zeigt, dass in solchen Fällen eine impulsive,
unmittelbare Hilfeleistung auftritt, die oft einen Wert von 100% erreicht.
(z.B: spontanes Zusammenbrechen einer Person in der U-Bahn -> Person wird
oft noch während des Fallens aufgefangen)
3. Warum helfen Menschen?
3.1 Gelernte
Hilfsbereitschaft
Für Lernerklärungen gelten dieselben Prinzipen, wie für Lerntheorien. Lernen
beinhaltet das Aneignen von Fertigkeiten um Helfen zu können, sowie das
Verständnis, warum genau diese gelernten Fähigkeiten jemand anderem helfen
können.
2 grundlegende Prozesse wurden in die Anwendbarkeit von Lerntheorien des
helfenden Verhaltens eingegliedert: Operantes Konditionieren und soziales
Lernen. Beim operanten Lernen helfen Menschen eher, wenn ihre zuvor
geleistete Hilfe positiv verstärkt wurde (vgl. Staub, 1979). Menschen können
aber auch lernen, nicht zu helfen. Das ist dann der Fall, wenn ihre geleistete
Hilfe zu negativen Konsequenzen geführt hat (vgl. Grusec, 1991; Staub, 1978).
Soziales Lernen, auch durch direkte Anweisung, ist ein effektiver Weg um
Helfen zu lernen. Vereinbar mit der allgemeinen Forschung von Einstellung und
Verhalten ist die Wirkungsweise der Beeinflussung durch die Art der Nachricht
und Merkmale des Publikums und des Beeinflussenden geleitet. Soziales Lernen
durch Beobachtung hat eine direkte und langfristige Wirkung auf Helfen (vgl.
Grusec, 1981).
Beeinflusst werden kann das prosoziale Muster durch:
- die Konsequenzen (positiver,
negativer oder neutraler Art), die die beobachtete Person erfährt,
- die Merkmale
(Status, Attraktivität, Gleichheit) der beobachteten Person,
- die Beziehung
zwischen Beobachter und Beobachteten
(Kind-Eltern Bindung).
Hilfsbereitschaft kann durch zeitweilige Zustände und Stimmungen, wie positive
Affekte, erhöht werden (Isen, 1993; Salovey et al., 1991).
Das elterliche Leitbild kann starken und
anhaltenden Einfluss auf Helfen ausüben. Fabes, Eisenberg und Miller (1990)
haben herausgefunden, dass Erstklässlerinnen Sympathie für notleidende Kinder
verspüren, wenn deren Mütter auch mitfühlend sind. Diese Kinder erstellen ein
Modell nach der Reaktion ihrer Mütter. Es gibt auch eine Verbindung zwischen
prosozialen Eltern Leitbild und dem Verhalten der Kinder im Erwachsenenalter
(Clary & Miller, 1986; Oliner & Oliner, 1988; Piliavin & Callero,
1991; Rosenhan, 1969).
Entwicklungsbedingt variiert die Beziehung zwischen der Art der
Belohnung und der Hilfsbereitschaft. Sehr junge Kinder sind durch spezifische
materielle Belohnung und Bestrafung motiviert, ältere Kinder durch soziale
Anerkennung und Pubertierente durch Selbstbestätigung und persönlicher
Überzeugung. Prosoziale Moral vollzieht sich entwicklungsbedingt (Eisenberg et
al., 1987; Eisenberg, Miller, Shell, McNalley, & Shea, 1991).
Vorschulkinder zeigen hauptsächlich Ich-bezogene und hedonistische, also nach
dem Genuss strebende, moralische Schlussfolgerungen, während ältere Kinder mehr
differenzierte, durchdachte und anders orientierte Arten zeigen . Ältere Kinder
helfen eher als Jüngere.
Grusec (1991) glaubt, dass Anweisung oder
materielle Belohung die Verinnerlichung von Hilfetendenzen der Kinder
untergräbt. Kinder, deren Hilfeleistung von der Belohnung abhängt, helfen
nicht, wenn die Belohnung nicht wünschenswert ist und entwickeln weniger
intrinsische Motive (Fabes, Fultz, Eisenberg, May-Plumlee, & Christopher,
1989).
3.2 Erregung und Affekt
Erregung und Affekt Theorien konzentrieren sich auf emotional basierende
Motivation. Generell ist der Grundbestandteil aber die Erwartung bei
entsprechendem Verhalten eine Belohung zu bekommen – z.B. sich besser fühlen.
Um echten Altruismus handelt es sich, wenn Menschen dazu motiviert sind, den
Zustand einer anderen Person in einer ganz besonderen Situation zu verbessern.
Es gibt einen persönlichen und sozialen Ansatz, der berücksichtigt, wie
persönliche Werte das Helfen anregen, wenn emotionale sowie kognitive Prozesse
involviert sind.
Kognitive Prozesse sind involviert in direktes und stellvertretendes
Lernen. Erregung und Affekt spielen eine entscheidende Rolle bei Helfen und
Altruismus. Menschen sind erregt, wenn sich andere in Notsituationen befinden
(vgl. Eisenberg & Fabes, 1991). Diese Reaktion tritt auch bei sehr jungen
Kindern, egal welcher Kultur, auf. Da dieses Phänomen so stark und universell
auftritt, vertreten viele Forscher die Meinung, dass einfühlende Erregung,
diese entsteht stellvertretend bei Notlagen anderer, ein biologisches und
evolutionäres Fundament hat (Cunningham, 1985/6); Hoffman, 1990).
Nach Pilvian et al. (1981) ist Erregung
„a central motivational concept“. Erregung motiviert den Zuschauer zur
Aktivität, die daraufhin nach einer Kosten-Nutzen-Analyse in einer bestimmten
Richtung ausgeführt wird.
Dieses Modell geht davon aus, dass
einfühlende Erregung entsteht, wenn wir das Leiden bzw. die Notlage anderer
Menschen bemerken.
Fabes, Eisenberg & Eisenbud (1993)
bekunden, dass Menschen emotional auf das Leid anderer reagieren.
Wenn „empathic arousal“ bei einer Person
auftritt, das auf das Leiden eines anderen Menschen zurück zu führen ist, führt
dies zu einer unerwünschten, emotionalen Erfahrung, welche die Person
reduzieren möchte. Ein effizienter Weg dafür ist das Helfen, verbunden mit
einer Reduktion des Leides des anderen.
Es muss nicht unbedingt sein, dass sich
ein Mensch wegen dem Leid oder dem Schmerz eines anderen schlecht fühlt, aber
er beginnt zu erfahren, was die andere Person fühlt (Vaughan & Lanzetta,
1980). Schon Kleinkinder reagieren auf das Leiden anderer mit besorgtem
Gesichtsausdruck und zusätzlicher körperlicher Erregung (Fabes et al., 1993).
Ebenso konnte bewiesen werden, dass bereits ein bis zwei Tage alte Babys mit
Weinen auf das Leiden anderer Babys „antworten“ (Sagi & Hoffman, 1976).
Menschen sind eher bereit zu helfen, wenn
die Erregung durch Menschen in fremden, belanglosen Situationen - wie z.B. in
aggressiven Filmen (siehe Mueller, Donnerstein, & Hallam, 1983) - ausgelöst
wird.
Menschen sind weniger bereit
Hilfestellung zu geben, wenn das Leid mit einem für sie unverständlichen Grund
oder Anlass assoziiert wird.
Laut Eisenberg (Eisenberg & Fabes,
1998) kann eine überhöhte einfühlende Erregung oder die Unfähigkeit diese zu
regulieren, auch zu einer Reduktion der Hilfsbereitschaft führen.
Das Kosten-Nutzen-Modell und das negative
Lageunterstützungsmodell (vgl. J.F. Dovidio & L.A. Penner 2001:
168-169) postulieren beide eine
egoistische Motivation für das Helfen. Es gibt jedoch zwei Unterschiede
zwischen den beiden Modellen:
Im Kosten-Nutzen-Modell spielt die
Erzeugung von Erregung eine zentrale Rolle. Diese Erregung führt zu einer
gewissen Zwangslage, welche die Person motiviert zu helfen.
Das Modell wird auch als
Spannungs-Reduktions-Modell bezeichnet, da das Leid eines anderen Menschen
einen erregenden Zustand in dem anderen auslöst. Sein Ziel ist es nun, diesen
Erregungszustand zu mildern, in dem er das Leid des anderen durch sein Helfen
reduziert oder zur Gänze beseitigt.
Das negative Lageunterstützungsmodell
postuliert stattdessen, dass ohne Berücksichtigung der auslösenden Quelle,
negative Zustände wie z.B. Schuld oder Traurigkeit (siehe Cialdini et al.,
1987) zum Helfen motivieren können. Durch den Vorgang des Helfens werden
nämlich die negativen Zustände eliminiert oder neutralisiert, das heißt, dass
der emotionale Zustand verbessert wird.
3.3 Empathie
3.31 Empathie und Emotion
Viele Forscher glauben, dass einfühlende
Erregung für das Helfen grundlegend und wichtig (vgl. Dovidio, 1984) ist.
Verschiedene Standpunkte werden, in Bezug auf die Art dieser Emotion und wie
Empathie eigentlich Menschen motiviert zu helfen, vertreten. Wenige stimmen in
der Art dieser Emotion und wie sie eigentlich Menschen motiviert zu helfen
überein.
Einfühlende Erregung erzeugt
verschiedenartige Emotionen. Bei schwerwiegenden Notsituationen können
unbeteiligte Zuseher verzweifelt und aufgebracht sein; bei weniger kritischen
und heftigen Problemsituationen können Zuseher sich ungut (Cialdini, Schaller,
et al., 1987), angespannt (Hornstein, 1982) oder beunruhigt und anteilnehmend (Batson, 1991) fühlen. Wie
im Endeffekt Erregung interpretiert wird, liegt an der Art von prosozialen
Motivation.
Was veranlasst die spezifische Emotion,
dass eine Person auf das Problem einer anderen Person reagiert?
Weiner (1980, 1986) geht davon
aus, dass durch ein Hilfebedürfnis eines
anderen der Zuseher zur Suche nach den Gründen stimuliert wird. Personen
streben nach dem Verständnis warum jemand Unterstützung braucht. Die wahrgenommen
Gründe werden dann analysiert. Zurückführung auf Verantwortlichkeit und
Kontrollierbarkeit sind besonders wichtige Dimensionen. Diese Attributionen
erzeugen ein affektives Erlebnis, das zu Handlungen motiviert.
Die Attribution auf unkontrollierbare
Ursachen erzeugt Sympathie, die zum Helfen motiviert.
Die Attribution auf kontrollierbare
Ursachen erzeugt Ärger, und kann zur Nichthilfe führen. Diese Attribute leiten
unsere Gefühle, aber emotionale Reaktionen bilden den Motor und Leitung des
Verhaltens (Weiner, 1980, p. 186).
Die Rolle von Empathie, also dem Einfühlungsvermögen, und emotionalen
Erfahrungen bei prosozialer Motivation sind der Fokus von mehreren Modellen des
Helfens, die angewiesen sind auf Erregung und Affekte als primäre Motivationspunkte
des grundlegenden Konstruktes Helfens und Altruismus. Negative Emotionen, wie
Schuld, können sehr leistungsfähige Motivatoren des Helfens sein. Menschen
helfen viel eher, wenn sie glauben, dass sie die Person verletzt haben (Salovey
et al., 1991).
Das Selbstwertgefühl leidet, wenn man annimmt jemanden unfairerweise
verletzt zu haben. Man versucht es daher wieder gut zu machen. Die Selbstwert-Wiedergutmachungs-Hypothese
sagt aus, dass durch eine positive soziale Erwiderung, das Selbstwertgefühl
wieder hergestellt ist und das Selbstverständnis „repariert“ ist. Die
Schulderwartung kann motivieren zu helfen. Menschen bieten ihre Unterstützung
an, weil sie durch Erfahrungen in der Vergangenheit vermeiden wollen, dass sie
sich schuldig fühlen, wenn sie nicht helfen, z.B. bei Freundschaften bei denen
Hilfestellungen normal sind, Eltern-Kind-Beziehung oder Arten von gemeinschaftlichen
Beziehungen (Baumeister, Stillwell, & Heatherton, 1994). Schuld ist die
stärkste und übliche Erfahrung in kommunalen Freundschaften.
Die Absicht, das Selbstverständnis zu „reparieren“ und Gefühle von
Schuld für Nichthilfe zu vermeiden, wenn es erwartet wird, wird nicht durch
alle Daten von negativen Affekten und Helfen erklärt. Es kann nicht geklärt
werden, warum Menschen eher helfen, wenn sie einfach nur Zeugen einer
Übertretung gegen jemand anderen sind.
3.32 Empathy – altruism hypothesis
Batson und seinen Kollegen (Batson, 1991)
stellen eine Empathie-Altruismus- Hypothese vor und sind der Meinung, dass
neben egoistischer Motivation ebenso ein wirklicher Altruismus existiert (vgl.
J.F. Dovidio & L.A. Penner 2001: 170).
Altruismus ist definiert als Helfen mit
dem grundliegenden Ziel, das Wohlbefinden des anderen zu verbessern.
Personen mit Problemen oder in Not
produzieren eine Bandbreite an emotionalen Erfahrungen wie beispielsweise
Traurigkeit, persönliches Leid, Besorgnis, etc. Es wird angenommen, dass
Traurigkeit und persönliches Leid eine egoistische Motivation bewirkt, während
einfühlende Besorgnis altruistische Motivation auslöst.
Der primäre Mechanismus in Batson`s
Modell ist die emotioale Reaktion auf Probleme anderer Personen.
Batson (1987, 1991) meint, dass Menschen
mit altruistischer Motivation helfen werden wenn:
- Hilfe möglich ist,
- die Hilfe dem oder der Betroffenen nützt und brauchbar ist, und
- die eigene Hilfe mehr Nutzen bzw. Erfolg
verspricht als von irgend einer anderen helfenden Person.
Batson et.al (1991, 1998) führten einige
Experimente durch.
Teilnehmer, die eine besonders starke
einfühlende Besorgnis, sogenannte empathic concern, erfahren, zeigen selbst
eine hohe Hilfsbereitschaft.
Es gibt 2 Formen von Empathie:
- Empathie als Erfahrung der Beobachter, die in einer Situation durch das Leiden einer
anderen Person ausgelöst wird, und
- Empathie als Persönlichkeitsmerkmal.
Empathie kann man als positive Zuwendung
gegenüber anderen Menschen bezeichnen bzw. als Begreifen und Nacherleben
innerer Vorgänge anderer (Stein, 1998). Empathie kann man als stellvertretende
Emotion auffassen, die erlebt wird, wenn andere in Not wahrgenommen werden
(Eisenberg & Miller, 1987).
3.33 Empathy – specific punishment
Diese Hypothese behauptet, dass die
Kosten bei einfühlender Besorgnis - jedoch keiner Hilfe - zu groß wären, sodass
die Menschen helfen möchten, auch wenn es Einsatz erfordert.
Von dieser Perspektive ausgehend, könnte
die altruistische Motivation, die Batson und seine Kollegen beschreiben, doch
auf Egoismus - basierend auf soziale
Kosten - zurückzuführen sein; assoziiert mit negativen Bewertungen, die andere
Menschen äußern könnten (Archer, 1984) oder mit
selbst auferlegte Kosten für eine Verletzung des persönlichen Standards
(Schaller&Cialdini, 1988).
Altruistische Motivation ist aber auch
dann zu beobachten, wenn keine sozialen Bewertungen möglich sind und die Personen
Informationen haben, die ihnen einen Grund geben nicht zu helfen und ihre
persönlichen Standards des Verhaltens bewahrt.
3.34 Empathy – specific reward
Es folgt eine andere alternative
Erklärung für die Evidenz von altruistischer Motivation.
Es wird behauptet, dass Menschen anderen
helfen, weil sie eine Belohnung bzw.
Gegenleistung vom Rezipienten erwarten. Einige spezifische Versionen von
dieser alternativen egoistischen Aussage und Erklärung wurden getestet. Eine beinhaltet den Wunsch,
die Freude des bzw. der anderen zu teilen, genannt „empathic joy“.
Smith, Keating und Stotland (1989) fanden
heraus, dass Teilnehmer, die besonders einfühlsam waren, mehr halfen, wenn sie
glaubten, dass sie aus den Konsequenzen des Helfens lernen könnten als die
Personen, die diesen Standpunkt nicht vertraten.
Batson et al., (1991) führte eine weitere
Studie durch und zeigte, dass Teilnehmer, die weniger Einfühlungsvermögen
erfuhren, vermehrt egoistisch motiviert waren. Sie halfen mehr, wenn sie
glaubten, sie würden aus ihrem Einsatz einen Nutzen ziehen – besonders, wenn
eine hohe Wahrscheinlichkeit bestand, dass sich die Situation des anderen
verbessern würde. Daraus entwickelt sich nämlich wieder „empathic joy“.
Wenn Menschen hauptsätzlich durch einen
persönlichen Wunsch nach Belohnung bzw. Entgeld motiviert sind zu helfen,
fühlen sie sich besser, wenn sie helfen, als wenn das irgendjemand anderer
macht. Im Gegensatz dazu fühlen sich Menschen, die altruistisch motiviert sind
zu helfen, besser, wenn sie wissen, dass der Person geholfen wird, ganz egal
wer der Helfende auch ist.
Eine weitere egoistische Interpretation
liefert Cialdini et al. (1987).
Er ist der Meinung, dass einfühlende
Menschen vielleicht eine größere Motivation zu helfen haben, weil die Empathie
Traurigkeit sowie einfühlende Besorgnis mit sich bringt. Es ist ein
egoistisches Bedürfnis diese Traurigkeit zu verringern. Menschen sind somit
dann bemüht und motiviert anderen zu helfen, um ihre eigene Traurigkeit zu
verringern. Untersuchungen (Cialdini et al., 1987, Studie 1) zeigten, dass
Empathie Traurigkeit und einfühlende Besorgnis auf hohem Level produzierte und
dass einfühlende, betroffene Personen mehr Hilfsbereitschaft aufzeigten, aber
nur, wenn sie glaubten, dass sich ihre negative Stimmungen und Gefühle durch
das Helfen verbessern würden (Cialdini et al., 1987, Studie 2).
Cialdini, Brown, Lewis, Luce und Neuberg
(1997) argumentieren, dass das Einfühlen in andere Personen zu einer
„self-other Überlappung“ oder „oneness“ (eins- sein) zwischen dem Helfer und dem Helfenden
führt. Das erhöht die Möglichkeit, dass
Empatie-bedingtes Helfen nicht selbstlos sein muss, weil die Hilfe ja indirekt
auch das Wohlbefinden des Helfers verbessert.
Cialdini et al. fand heraus, dass
empathic concern nicht direkt zum Helfen führt, jedoch mit „oneness“
korreliert, was ja das Bedürfnis zu helfen auslöst.
Es ist schwierig die Frage „altruism
versus egoism“ als eine motivationale Basis für prosoziale Aktivitäten klar zu
beantworten. Jedoch wird angenommen, dass wahre altruistische Motivation
existiert und nicht jede Hilfe egoistisch angetrieben sein muss.
3.35
Empathie als Ergebnis der Sozialisation
Es lässt sich nachweisen, dass ein
geringer, aber systematischer Zusammenhang zwischen Empathie und prosozialem
Verhalten besteht.
Experiment: Empathie und emotionale
Regulierung bei Kindern
(Eisenberg et al., 1993)
Eisenberg untersuchte Kindergarten-Kinder
und Schulkinder aus der dritten Klasse sowie deren Mütter. Im ersten Teil der
Untersuchung war eine Versuchsleiterin anwesend. Über einen Lautsprecher wurde
der Ton eines schreienden Kindes in den Versuchsraum eingespielt. Die
Versuchsleiterin gab an, für einen Freund ein Baby betreuen zu müssen, das sich
im Nachbarraum des Gebäudes befand, und versuchte es zu beruhigen. Außerdem
ermutigte sie das Kind, genauso vorzugehen. Das Kind bekam die
Zusatzinformation, dass man den Lautsprecher ausschalten kann, sodass man das
Baby nicht mehr hören kann. Daraufhin verließ die Versuchsleiterin den Raum und
das Babygeschrei wurde wieder eingespielt. Währendessen wurde der
Gesichtsausdruck des Kindes von einem neutralen Beobachter auf Unbehagen
beurteilt und die Tonlage seiner Stimme auf einer Skala, die von unterstützend
bis irritiert reichte, eingetragen. Als abhängige Variable wurden die Sekunden,
die das Kind mit dem Baby sprach, gezählt. Das Ausmaß des persönlichen
Unbehagens war negativ mit diesem Maß der Hilfeleistung korreliert. Aber die
Tonlage der Stimme stellte sich in Bezug auf Hilfsbereitschaft als unbedeutend
heraus.
Weitere Daten über die Fähigkeit, die
Perspektive anderer zu übernehmen, wurden von den Müttern erhoben. Diese
Fähigkeit korrelierte negativ mit dem beobachteten persönlichen Unbehagen der
Kinder während des Babygeschreis und positiv mit der unterstützenden Tonlage
der Stimme. Diese Ergebnisse traten aber nur für Mädchen auf.
In einer zweiten Studie von Fabes et al.
(1994) mit Kindergarten Kindern und Schülern aus der zweiten Klasse wurde
versucht, eine physiologische Grundlage für die emotionale Reaktion in der
Babyschrei-Episode zu ermitteln. Dazu wurde die Variabilität der Herzrate
herangezogen, die als Index der Emotionsregulation dienen kann. Je mehr
Variabilität während der Babyschrei-Episode gegeben war, desto unterstützender
war die Tonlage der Stimme bei Jungen und Mädchen. Daraus schloss man, dass die
Variabilität der Herzrate als physiologische Kennung für empathische Reaktionen
in Hilfesituationen bei Kindern dienen kann.
Obwohl die Ergebnisse Unterschiede bei
den Geschlechtern aufweisen, zeigen sie doch, dass Empathie mit
Ausdrucksmerkmalen zusammenhängt und schon bei Kindern zu beobachten ist. Sie
lässt sich als Ausdruck der Emotionsregulation auffassen. Eine stärkere
Emotionsregulation der Kinder hängt mit bestimmten Aspekten des prosozialen
Verhaltens zusammen. Ergänzend ist anzumerken, dass in einer Untersuchung von
Eisenberg et al. (1995) festgestellt wurde, dass das prosoziale Verhalten von
Schulkindern, das durch Einschätzungen ihrer Mitschüler erfasst wurde, mit der
Beurteilung der Kinder durch ihre Lehrer im Hinblick auf ihre
Emotionsregulation zusammenhing. Je positiver die Emotionsregulation beurteilt
wurde, desto höher wurde die soziale Kompetenz der Kinder geschätzt.
3.36
Dispositionale Empathie als Erklärung hilfreichen Verhaltens
Die situative Empathie kann man der
dispositionalen Empathie gegenüberstellen. Sie stellt ein allgemeines
Persönlichkeitsmerkmal dar, das durch Anlagefaktoren kombiniert mit
Sozialisationseinflüssen bestimmt wird. Empathie als Persönlichkeitsmerkmal
wird von Davis (1983) gemessen. Beispielitems: „Ich tagträume und fantasiere
mit einiger Regelmäßigkeit über Dinge, die in meinem Leben geschehen könnten“,
„ Ich habe oft liebevolle, besorgte Gefühle für Leute, die weniger glücklich
sind als ich“, „ Ich finde es manchmal schwierig, Dinge aus der Perspektive
anderer Leute zu sehen“
Die dispositionale Empathie korreliert
signifikant mit der Hilfeleistung.
Situative und dispositionale Empathie wirken sich unabhängig von
einander aus. Situatives und dispositionales Mitgefühl korrelieren etwa mit
r=0.30.
Der Begriff Empathie hat also 2
Bedeutungen. Einmal ist er eine situative Empfindung, die eine Person in einer
Notlage einer anderen Person hat, und einmal als allgemeine
Persönlichkeitsorientierung, die auch in einer neutralen Situation abgefragt
werden kann.
3.4
Altruistisches Motivsystem
Batson und Mitarbeiter: Gibt es neben
dem egoistischen auch ein altruistisches Motivsystem?
Die Frage nach den Motiven der
Hilfeleistung hat zu verschiedenen Antworten geführt. Einerseits gibt es offene
und versteckte Belohnungen, dazu zählen soziale Billigung oder das sich eine
Person selbst wegen angemessenem Verhalten gratuliert, andererseits gibt es die
Möglichkeit dass Hilfeleistung zur Beendigung einer negativen emotionalen
Erregung beiträgt. Zusätzlich erklärt man, dass Hilfeleistung meist dann
wahrscheinlich ist, wenn ein starkes zusätzliches Unbehagen über die Lage einer
Person gegeben ist und wenn durch das Ende der Notlage eine empathische Freude
ausgelöst wird. Schlussfolgernd dazu kann man sagen, dass sich ein Zusammenhang
zwischen Empathie und Hilfeleistung erwarten lässt, der sich aber schon auf
Basis egoistischer Tendenzen erklärt.
Batsons (1995) Forschungsprogramm zur
Empathie Altruismus Hypothese mit zugrunde liegendem altruistischen
Motivsystem: Wenn persönliches Unbehagen eine unangenehme Emotion ist, die
durch Hilfeleistung beendet werden kann, sollte auch ein Verlassen der
Situation, in der sich das Opfer befindet, die negative Befindlichkeit des Beobachters reduzieren. Daher die
Theorie, dass egoistische Menschen dann helfen, wenn sie keine
Fluchtmöglichkeiten mehr sehen. Eine altruistisch motivierte Person sieht
hingegen in einer Fluchtmöglichkeit keine Alternative, das Vorhanden sein einer
Fluchtmöglichkeit spielt somit keine Rolle. Ihr empathisches Motiv besteht
darin, das Leiden des Opfers zu beenden und sie sollte in beiden Fällen
gleichermaßen sehr hilfsbereit sein.
Batson (1995) will damit unter Beweis
stellen, dass es neben dem egoistischen auch ein altruistisches
Motivationssystem gibt. Er variiert mit der Leichtigkeit des Verlassens der
Notsituation und andererseits mit dem Niveau der Empathie. Batson nimmt an,
dass hohe Empathie gleichbedeutend mit altruistischer Motivation ist. Es gibt
dabei die Vorhersage, dass in 3 von 4 Bedingungen des Versuchsplans eine hohe
Hilfsbereitschaft eintreten wird, während bei niedriger Empathie und leichter
Fluchtmöglichkeit die Hilfsbereitschaft verringert sein sollte. Diese 1:3
Hypothese wurde in verschiedenen Untersuchungen bereits überprüft.
Zwei Hypothesen lassen sich dabei
unterscheiden (Batson 1995):
- eine
auf Grund von persönlichem Unbehagen und
- eine
auf Basis seiner Empathie-Altruismus Hypothese.
Persönliches Unbehagen führt zu der
Annahme, dass das Niveau einer Hilfeleistung niedrig ist, wenn es eine
Fluchtmöglichkeit gibt. Im Gegensatz dazu wird ein hohes Hilfeleistungsniveau
bei geringer Fluchtmöglichkeit voraus gesagt.
Dagegen sagt die Empathie-Altruismus
Hypothese voraus, dass bei einer leichten Fluchtmöglichkeit aber hoher Empathie
eine hohe Hilfeleistung auftreten wird.
Folgende Tabelle veranschaulicht beide
Hypothesen von Batson:
|
1. Reduktion persönlichen Unbehagens |
|
|
|
|
Niedrige Empathie |
Hohe Empathie |
|
Leichte Fluchtmöglichkeit |
Niedrig |
Niedrig |
|
Schwierige Fluchmöglichkeit |
Hoch |
Hoch/sehr Hoch |
|
|
|
|
|
2. Empathie-Altruismus-Hypothese |
|
|
|
|
Niedrige Empathie |
Hohe Empathie |
|
Leichte Fluchtmöglichkeit |
Niedrig |
Hoch |
|
Schwierige Fluchtmöglichkeit |
Hoch |
Hoch |
Tabelle 3.1
Zusammenfassung der Annahme Batsons (1995):
Er unterscheidet zwischen egoistisch und
altruistisch motivierter Hilfe, wobei egoistisch motivierte Hilfe das eigene
Wohlergehen maximieren soll, und die altruistische Hilfe zum Ziel
hat, das Wohlergehen der anderen zu maximieren. Er geht davon aus, dass die Verbesserung des
Wohlbefindens eines anderen als Ziel die Erreichung eines altruistischen
Zielzustandes betrifft. Zusätzliche persönliche Gewinne werden als Nebeneffekt
bezeichnet. Die egoistische Hilfsbereitschaft wird auf persönliches Unbehagen
zurückgeführt, welches nur durch Hilfeleistung oder Verlassen der
Opfersituation verringert werden kann.
2
Experimente: Studien zum wahren Altruismus
Batson et al. (1981): Führte ein
Experiment durch, an dem eine Studentin namens Elaine angeblich Elektroschocks
erhält, die aber nur simuliert sind, ohne dass die Beobachter das erkennen
können. Die Versuchspersonen, die das Leiden von Elaine beobachten, erfahren,
dass sie zehn aversive Durchgänge überstehen muss. Bei leichter
Fluchtmöglichkeit soll die Versuchsperson nur zwei Durchgänge beobachten,
während sie bei schwieriger Fluchtmöglichkeit alle zehn Durchgänge beobachten
soll. Nach 2 Durchgängen unterbricht Elaine den Versuch und bekennt gegenüber
dem Versuchsleiter, dass sie, was Stromstöße angeht, belastet ist, da sie einen
Unfall an einem Elektrozaun hatte, der sich für sie traumatisch ausgewirkt hat.
Darauf hin fragt der Versuchsleiter die Versuchsperson, ob sie für Elaine
einspringen will. Er fügt hinzu, dass Elaine ansonsten bereit ist, mit dem
Versuch weiterzumachen.
In dieser Versuchssituation wurde das
Ausmaß der Empathie über Ähnlichkeit manipuliert. Zur Auslösung von hoher
Empathie wurde der Eindruck vermittelt, dass Elaine und die Versuchsperson sich
in ihren Einstellungen sehr ähnlich sind. Bei geringer Empathie wurde der
Eindruck vermittelt, dass sich Elaine und die Versuchsperson in ihren
Einstellungen sehr unähnlich sind. Als Maß der Hilfeleistung diente die
Bereitschaft, für Elaine einzuspringen. Diese Bildung, der abhängigen Variablen
ist zweifelsohne eine Stärke der Versuchsreihe, die von Batson berichtet wird,
da sie verhaltensorientiert und einfach zu interpretieren ist.
Die Ergebnisse unterstützen die
Empathie-Altruismus-Hypothese, da bei leichter Fluchtmöglichkeit und gegebener
Unähnlichkeit mit einem Wert von 18% Bereitschaft eine besonders niedrige
Hilfeleistung auftritt, während bei hoher Ähnlichkeit generell eine hohe
Hilfsbereitschaft (91% bei leichter und 82% bei schwerer Fluchtmöglichkeit)
beobachtet wurde. Bei Unähnlichkeit und erschwerter Fluchtmöglichkeit fand sich
eine mittlere Hilfsbereitschaft von 64%, die im Sinne der 1:3 Erwartung als
hoch interpretiert wird.
In einem zweiten Experiment von Batson
und seinen Mitarbeitern (1981) wurde eine andere Manipulation der Empathie
gewählt. Dazu wurde eine Fehlattribution verwendet. Den Versuchspersonen wurde
eine Placebo-Tablette gereicht, von der behauptet wurde, dass sie bestimmte
Nebeneffekte auslösen würde. In der empathischen Bedingung wurde gesagt, dass
sie Tablette Unwohlsein und Unbehagen auslöst. Auf diese Weise wurde mögliches
Unbehagen bei der Beobachtung der Notsituation von Elaine auf die Tablette
zurückgeführt, sodass die wahrgenommene Empathie intensiviert werden sollte. In
der zweiten Bedingung wurde angekündigt, dass die Tablette als Nebeneffekt
Wärme und Sensibilität auslösen würde, sodass in dieser Bedingung
Begleiterscheinungen der Empathie rationalisiert wurden. Als Folge davon sollte
das persönliche Unbehagen dominieren, also eine egoistische Motivation.
In diesem Experiment wurde erneute die
Fluchtmöglichkeit als leicht oder schwer variiert. Das Ergebnismuster war
wieder im Sinne der 1:3 Hypothese. Niedrige Hilfsleistung trat bei Dominanz des
persönlichen Unbehagens kombiniert mit leichter Fluchtmöglichkeit auf (33%
Bereitschaft). Hingegen fand sich eine höhere Hilfsbereitschaft bei
persönlichem Unbehagen kombiniert mit schwerer Fluchtmöglichkeit (75%), bei
Dominanz der empathischen Empfindung und leichter Fluchtmöglichkeit (83%), und
bei Dominanz der empathischen Beteiligung und schwerer Fluchtmöglichkeit (58%).
Daher kommen Batson und seine Mitarbeiter zu dem Schluss, dass empathische
Motivation wahrhaft altruistisch ist.
Eine Variante dieser Versuchsanordnung
wurde von Toi und Batson (1982) verwendet. Erneut wurde die Fluchtmöglichkeit
als leicht oder schwer variiert. Die Empathie wurde diesmal auch verschieden
aufgeteilt, indem die Versuchsteilnehmer instruiert wurden, das Opfer zu
beobachten (niedrige Empathie) oder sich in das Opfer hineinzuversetzen (hohe
Empathie). In dieser Untersuchung wurde eine neue Notlage verwendet, die darauf
zurückgeführt wurde, dass das Opfer Carol nach einem Autounfall ihr Studium
wegen eines Krankenhausaufenthaltes nicht fortsetzen kann. Sie hat einen Brief
an den Professor geschrieben mit der Bitte, ob ein Student, der dieselbe
Veranstaltung besucht, bereit ist, ihr zu helfen. Bei leichter
Fluchtmöglichkeit wurde mitgeteilt, dass das Opfer zu Hause an den Rollstuhl
gefesselt sei. Bei schwieriger Fluchtmöglichkeit wurde mitgeteilt, dass das
Opfer in der nächsten Woche in die Klasse zurückkehren werde. Erneut fand sich
das erwartete 1:3 Ergebnismuster mit geringer Hilfeleistung bei leichter
Fluchtmöglichkeit, kombiniert mit der Instruktion, das Opfer zu beobachten.
In diesem Experiment wurde eine weitere
interessante Variation des 1:3 – Themas durchgeführt. Die Versuchspersonen
beantworteten einen Fragebogen, der Adjektive enthielt, die ihr persönliches
Unbehagen und ihr Mitgefühl erfassen sollten. Persönliches Unbehagen wurde durch
Eigenschaften wie gekränkt, aufgebracht und ärgerlich erfasst. Mitgefühl wurde
durch Eigenschaften wie sympathisch, gerührt und gesellig gemessen. Zwischen
diesen beiden Skalen wurde die Differenz berechnet, die als ein Maß der
selbsteingeschätzten relativen Empathie benutzt wurde. Wenn persönliches
Unbehagen überwog, war diese selbsteingeschätzte Empathie niedrig. Wenn das
Mitgefühl überwog, war sie hoch.
Die Versuchspersonen wurden nun danach
gruppiert, ob sie eher niedrige oder hohe selbsteingeschätzte relative Empathie
aufwiesen. Bei denjenigen, bei denen persönliches Unbehagen überwog, fand sich
wie üblich eine geringe Hilfsbereitschaft, wenn eine leichte Fluchtmöglichkeit
gegeben war, und eine hohe Hilfsbereitschaft bei schwerer Fluchtmöglichkeit.
Demgegenüber zeigten die relativ empathischen Versuchsteilnehmer in beiden
Bedingungen eine hohe Hilfsbereitschaft.
An diesem Versuch lässt sich Kritik
verdeutlichen. Bei einer hohen Empathie kann eine Flucht sinnlos sein, da eine
hohe Belohnung aufgrund der Freude über die Beendigung des Leidens des Opfers
zustande kommen kann. Bei niedriger Empathie kann eine Flucht sinnvoll sein,
wenn die stellvertretende Belohnung gering ausfällt und insofern nichts zu
gewinnen ist, wenn man von einem egoistischen Standpunkt ausgeht. Die Analyse
weist darauf hin, dass das 1:3 Muster auch auf der Basis einer rein
egoistischen Interpretation abgeleitet werden kann. Es ist kein eindeutiger
Beweis für eine Empathie-Altruismus-Hypothese, obwohl sie damit in guter
Übereinstimmung steht.
3.5 Negative state relief model
Dieses Modell wurde 1982 von Cialdini, Kenrick und Baumann entwickelt.
Einer anderen Person zu schaden oder das Zusehen, wie einer anderen
Person geschadet wird, kann zu negativen Gefühlen wie Schuld oder Traurigkeit
führen. Menschen sind dann motiviert diese negativen Gefühle zu reduzieren.
Durch Sozialisierung und Erfahrungen können Menschen lernen, dass Helfen als
sekundärer Verstärker dient (Williamson & Clark, 1989; Yinon & Landau,
1987). Positive Gefühle, die von Helfen
abgeleitet werden, können negative Stimmung abbauen. Negative Stimmung, wie
Schuld und Betroffenheit, kann dazu motivieren, jemanden zu helfen, schließlich
bewirkt Helfen die Belohnung des sich besser Fühlens. Im Gegensatz zur Image-reparation
Hypothese, beabsichtigt das negative Lageunterstützungsmodell, dass Menschen
eher motiviert sind sich gut zu fühlen, als gut dazustehen. Die Motivation ist
in beiden Theorien hauptsächlich egoistischer Natur. Die primäre Motivation
einer anderen Person zu helfen ist, dass sich die Situation des Helfenden
verbessert.
Es gibt 3 Annahmen über das negative Lageunterstützungsmodell:
- Annahme, dass die Motivation zu helfen in einer Auswahl von Quellen
begründet ist. Die Schuld jemanden verletzt zu haben und die
Betroffenheit, als Zeuge eine unglückliche Situationen von einem anderen
wahrzunehmen, sind negative Erfahrungen, die beide motivierend auf Helfen
wirken (Cialdini, Darby, & Vincent, 1973). Diese Effekte scheinen das
Helfen als Antwort anzuregen; negative Stimmung lässt generell die
Erfüllung nicht steigen (Forgas, 1998).
- Annahme, dass andere Ereignisse neben dem Helfen, zu einem besseren
Gefühl führen. Die Belastung dieser Ereignisse, verursacht durch die
negative Lage, unterstützt die Motivation zu helfen. Wenn ein anderes
Ereignis die Stimmung des Helfers verbessert, dann führt dies zur
Gelegenheit des Helfens (Cialdini et al., 1973) oder der Helfer steigert
seine Stimmung über einen einfacheren Weg (Comedy Kassette hören, Schaller
& Cialdini, 1988). Die Folge ist, dass der Helfer nicht mehr zum
Helfen motiviert ist.
- Annahme, dass schlechte Stimmung zur Hilfe motiviert, ist nur
gegeben, wenn der potentielle Helfer glaubt, dass durch Helfen seine
Stimmung verbessert wird. Negative Stimmung unterstützt das Helfen nicht,
wenn Menschen glauben, dass die negativen Gefühle nicht abgelöst werden
(Manucia, Baumann & Cialdini, 1984) oder wenn die
Selbstbelohungseffekte und Wirkungen noch nicht entwickelt sind, so wie
bei jüngeren Kindern (Cialdini & Kenrick, 1976; Cialdini et al.,
1982).
3.6
Normative Theorien
Auf der normativen Ebene wird davon
ausgegangen, dass soziale Werte und Normen prosoziales Verhalten beeinflussen.
Die Norm der sozialen Verantwortung spielt dabei eine große Rolle. Das hängt
damit zusammen, dass mit sozialer Verantwortung Gefühle der Verpflichtung
einhergehen, sich für Personen in Not einzusetzen.
Der Begriff der sozialen Verantwortung
verweist auf ein ethisch-moralisches Bezugssystem (Auhagen, 1999).
Verantwortung setzt interpersonelle Beziehungen voraus.
Soziale Verantwortung ist für viele
Lebensbereiche bedeutsam (Reichle & Schmitt, 1998). Ein wichtiger
Verantwortungsbereich liegt beim Beruf im Bereich sozialverantwortliches
Verhalten. Weiterhin geht es um Verantwortung für die Umwelt. Zuschreibung der
Verantwortung auf sich selbst ist der stärkste Prädiktor von persönlichen
Verhaltensbereitschaften zum Schutz der Natur.
Menschen, die ein hohes Maß an sozialem
Verantwortungsbewusstein haben, sind durch Verlässlichkeit bei der Erfüllung
sozialer Pflichten und Bereitschaft zum persönlichen Engagement gekennzeichnet
(Berkowitz & Daniels, 1964). Es gibt 2 Dimensionen des
Verantwortungsbewusstseins, die mit Erfüllung von berechtigten Erwartungen
anderer und Befolgung von sozialen Spielregeln bezeichnet werden (Bierhoff,
2000).
Bei Erfüllung berechtigter Erwartung
anderer geht es darum, dass eine Person sich im sozialen Leben konsistent und
zuverlässig verhält.
Handeln im Sinne der Norm der sozialen
Verantwortung setzt Eigeninitiative voraus.
Heckhausen (1989) behauptet, dass er
internale Kontrollüberzeugungen als eine generalisierte Form der sozialen
Verantwortung bezeichnet. Demgegenüber sind Ängste, Empfindungen und
Unsicherheiten, die sich auf Einschätzung der eigenen sozialen Fähigkeiten
beziehen, negative Prädiktoren der Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme (Bierhoff, Klein & Kramp, 1991).
Die Befolgung der sozialen Norm hängt mit
Empathie zusammen (Penner & Finkelstein, 1998) Soziale Verantwortung ist in Unternehmen mit
freiwilligen Arbeitsengagement verbunden (Bierhoff & Herner, 1999). Dabei
wird hervorgehoben, dass Verantwortung etwas mit Selbstbestimmung des
Verhaltens zu tun hat, denn das freiwillige Arbeitsengagement lässt sich als
ein selbstbestimmtes Engagement kennzeichnen, das auf persönlicher
Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter beruht.
3.61 Soziale Normen und persönliche
Standards
Normativ helfen Menschen anderen, weil
sie Erwartungen haben, die auf früherem sozialen Lernen oder aktuellem
Verhalten anderer basieren.
„Hilfe“ wird angesehen als eine Funktion,
entstehend aus dem Druck durch Gruppenerwartungen in Bezug auf adäquates
(angemessenes) Verhalten, das unterstützt wird durch soziale Sanktionen und
Belohnungen (vgl. Schwartz & Howard 1982: 346). Gründe für ehrenamtliche
Arbeiten sind beispielsweise Erwartungen anderer, die erfüllt werden sollten.
2 Klassen von sozialen Normen sind ins
Helfen involviert (Gouldner, 1960):
- Gefühle der Fairness
- perceptions of reciprocity - Auffassung bzw. Vorstellung von Wechselseitigkeit
und equity / social justice - Gerechtigkeit/ Gleichheit (Lerner,
1980)
3.62 Social responsibility
Nach Berkowitz & Daniels (1963) wird
unter sozialer Verantwortung die Erwartung verstanden, dass demjenigen, der von
Hilfestellungen abhängt, auch geholfen wird
selbst dann, wenn keine Gegenleistung oder Gewinn/Nutzen angeboten wird
(vgl. J.F. Dovidio & L.A. Penner 2001: 174)
Umso größer die Notlage ist, desto
gewillter sind die Menschen zu helfen (Piliavin et al., 1981). Aber es gibt
auch Grenzen bei der „Regel“ der sozialen Verantwortung - nämlich wenn die
verflochtene Beziehung ungewollt ist und/oder wenn die persönliche Freiheit,
Wahl und der persönliche Freiraum
bedroht sind (Berkowitz, 1973) Bei der sozialen Verantwortung sind kulturelle Unterschiede
festzustellen:
Individualistische Kulturen haben weniger
„social responsibility norms“ als kollektivistische Kulturen (Ma, 1985).
3.63 Persönliche Normen, Ziele und
Selbst-Konzept
Die generellen Normen der sozialen
Verantwortung sind nur vage Richtwerte für ein Verhalten in konkreten
Situationen. Der Gebrauch von persönlichen Normen und Standards ist wertvoll
zum „Berechnen“ des Verhaltens einer Person in einer spezifischen Situation.
Verinnerlichte moralische Werte und persönliche Normen können zum Helfen
motivieren - kognitiv und affektiv. Die kognitive Komponente beinhaltet
Erwartungen von Verhalten, das auf persönliche Standards basiert. Die affektive
Komponente betrifft die emotionale Reaktion (z.B. stolz, schuldig fühlen,…).
Persönliche Normen sagen Hilfestellungen
besser vorher als soziale Normen (Schwartz & Howard, 1982).
Menschen, die ihre Hilfsbereitschaft in
ihrer Selbstzuschreibung begründet sehen und ein Selbstkonzept entwickeln,
zeigen ein hilfsbereites Verhalten (Grusec, 1991; Swinyard & Ray, 1979).
Die Menschen, die Geld als Hilfe zur
Verfügung stellen oder von außen zur Hilfe gedrängt werden, helfen weniger
altruistisch motiviert als sie es ohne diese
Anreize tun würden, welche sie auch in
Zukunft weniger hilfsbereit sein lassen werden (Batson et al., 1987).
In spontanes sowie nicht spontanes Helfen
wie z.B. ehrenamtliche Tätigkeiten können eigene Interessen involviert sein wie
beispielsweise Geld spenden, um Bestätigung, Respekt und Anerkennung von
anderen zu erhalten oder um auf der Karriereleiter noch höher hinauf klettern
zu können.
In Studien über „volunteerism“ (Daniels,
1988; Skills 1957) wurde herausgefunden, dass das Interesse und die Besorgnis
für andere mit dem persönlichen Interesse, dem Gefühl der Macht und Überlegenheit,
dem Wunsch nach sozialen Kontakt und anderen selbstzentrierten Motiven
auftreten.
Ob eine Aktivität nun stattfindet oder
nicht wird mit Hilfe des Selbstkonzepts und Werten anhand „cost-reward“
Überlegungen und affektiven Reaktionen
bei Gelegenheiten zum Helfen entschieden. Gesellschaftliche
Verpflichtungen zum Helfen wie z.B.
Blutspenden oder ehrenamtliche Tätigkeiten können zur Entwicklung einer
Rollen-Identität führen (Grube & Piliavin et al., 1998; Striker, 1980).
Zum Beispiel kann es dann sein, dass mich
nicht mehr meine eigene moralische Verpflichtung und persönliche Identität zum
Blutspenden bewegt, sondern die Erwartung bedeutsamer anderer Menschen. Die
eigene Identität kann gesellschaftlich geformt werden - vermittels sozialer
Rollen und anderen Erwartungen (Deaux & Stark, 1996).
3.7
Collectivism: benefiting another to benefit a group
Unter
“Collectivism” versteht man die Motivation, das eigene Wohl, dem einer Gruppe,
unterzuordnen. Das ultimative Ziel hierbei ist es somit nicht sich selbst zu
bereichern, sondern die Gruppe und stellt damit einen weiteren Ansatz dar um
prosoziales Verhalten zu erklären.
3.71 Social dilemma
„Not me or thee but we“ (Dawes et al.; 1988)
Robyn Dawes und
seine Kollegen wiesen darauf hin, dass die
„collectivist motivation“ als Produkt der Gruppenidentität verstanden
werden kann und auf sogenannte social dilemmas abzielt.
Soziale Dilemma
kommen zustande, wenn:
- ein einzelnes Individuum in der Gruppe
eine Entscheidung über die Verteilung von Ressourcen (wie z.B.
Geld, Zeit, etc.) treffen muss und
- die Zuteilung zur Gruppe mehr Nutzen für die
Gruppe als Ganzes bringt, jedoch die Bevorzugung des Einzelnen,
demjenigen von größerem Nutzen ist als es der Gruppe zuteilen ist.
Personen die
sich innerhalb eines social dilemmas für das Wohl der Gruppe entscheiden,
handeln somit kollektivistisch motiviert.
3.72
Kollektivismus und egoistische Motive
Ähnlich wie
beim Altruismus stellt sich die Frage ob im Endeffekt nicht alles auf
egoistische Motive reduzierbar ist. Eventuell ist das Interesse für das Wohl
der Gruppe ein differenzierterer Ausdruck für das Wohl am eigenen Interesse,
z.B. könnte man das ignorieren der Bedürfnisse seiner Gruppe, im Vergleich zu
den eigenen Bedürfnissen, auf Dauer als schädigend für das eigene Wohl
verstehen. Die Konsequenz wäre eine Maximierung des Nutzens für die Gruppe, um
auf lange Sicht den eigenen Nutzen zu maximieren. Eine Erkenntnis die u.a. von
Politikern und Aktivisten verwendet wird um auf die Bedürfnisse der
Gesellschaft aufmerksam zu machen. Sie warnen z.B. vor Langzeit-Konsequenzen
für uns und unsere Kinder durch Umweltverschmutzung und Ressourcenplünderung.
Eine direkte
Gegenposition, und somit die Meinung, dass Kollektivismus unabhängig von
egoistischen Motiven abläuft, wird von Dawes et al. vertreten. Sie führten
Experimente zu dem bereits erörterten sozialen Dilemma durch und kamen zu dem
Ergebnis, dass Versuchspersonen, welche zuvor mit der Gruppe über die
Ressourcenverteilung diskutiert hatten, öfter zu einer kollektivistisch
motivierten Verteilung griffen, als andere, die die Entscheidung ohne
vorangegangene Diskussion treffen mussten.
Dawes et al.
meinte somit die zwei plausibelsten Erklärungen vor egoistische
Verhaltensweisen ausgrenzen zu können und zwar:
- differenziertes Selbst-Interesse und
- sozial verankerte Gewissenhaftigkeit.
Trotz der
Wichtigkeit dieser Erkenntnis kann sie noch nicht als gegeben verstanden werden
und bedarf weiterer Untersuchungen. Derweil kann nur auf die Thematik der
normativen Theorien verwiesen werden um ein fundierteres Verständnis für
prosoziales Verhalten zu erlangen.
3.8 Fairness
Ein wichtiger Punkt der Fairness ist die
Gegenseitigkeit bzw. Wechselseitigkeit.
Laut dieser Norm sollten Menschen
denjenigen Menschen helfen, die ihnen auch geholfen haben und sollten die, von
denen sie keine Hilfestellung erhalten haben, auch nicht unterstützen
(Gouldner, 1960).
Nach Kahn und Tice (1973) gibt eine
Person umso mehr, desto größer die selbsterfahrene Unterstützung ist.
Für jede gelegentliche Beziehung ist
diese Gegenseitigkeit wichtig, die eine „Rückzahlung“ von Unterstützung
beinhaltet (Clark & Mills, 1993).
In intimeren Beziehungen ist diese
Gegenseitigkeit schwächer, obwohl es natürlich auch darauf ankommt, wie das
Gegenüber auf Bedürfnisse eines Selbst reagiert. Doch in solcher Art von
Beziehung sind die Personen besorgt umeinander und gegenseitige Hilfe wird
vorausgesetzt.
Gegenseitigkeit ist die Basis und ein
fundamentaler Aspekt von menschlichem, sozialem Austausch.
Miller und seine Kollegen (e.g., Miller
& Bersoff, 1994) meinen, dass verschiedene Kulturen auch verschiedene
Gründe haben, warum sie sich verpflichtet fühlen, einen Gefallen zurück zu
geben.
Das Anliegen auf Fairness und Balance
steht ebenso in Verbindung mit „equity“.
Gleichheit existiert, wenn Menschen in
einer Beziehung glauben und das Gefühl
haben, dass ihr Input und Output ausgeglichen sind (Walster et al., 1978). Wenn
Menschen eine gewisse Ungleichheit bemerken, sind sie gewillt, die Gleichheit
wieder herzustellen. Gleichheit
ist ebenso ein Motiv des Helfens. Menschen, die zu viel Gewinn, Belohnung
und/oder Unterstützung erhalten haben, entschließen sich oft dazu, etwas von
ihrem Gewinn abzugeben (Schmitt & Marwell, 1972). Fühlen sich Menschen
jedoch unterkompensiert, sind sie weniger hilfsbereit (Organ & Ryan, 1995).
Das Bedürfnis, die Welt fair zu sehen,
beschreibt die „just- world hypothesis“
(Lener, 1980). Sie behauptet, dass
Menschen motiviert sind anderen zu helfen, wenn diese unfair behandelt wurden.
Menschen, die besonders stark an eine „just- world“ glauben, sind motiviert und
gewillt eine machtvolle Position zu erlangen, um mit anderen Ressourcen zu
teilen und die Welt fairer zu machen (Foster & Rusbult, 1999).
3.9 Biologische Motive für das Helfen und Altruismus
Erklärungen über menschliches, soziales
Verhalten, die auf der Evolutionstheorie beruhen, sind seit wenigen Jahren
gesellschaftlich und wissenschaftlich akzeptiert (Buss & Kenrick, 1998).
Empathie spielt eine zentrale Rolle beim Helfen und in Bezug auf Altruismus und
entsteht in einem speziellen Teil im menschlichen Gehirn - im limbischen
System.
Es gibt dem Menschen die Fähigkeit, sich
in andere Menschen einzufühlen (Carlson, 1998). 1985 berichtete MacLean, dass
diese Gehirnstruktur bereits sehr früh in der menschlichen, evolutionären
Geschichte – vor über 180 Millionen Jahren existierte.
Zwillingsstudien (e.g.
Davis, Luce, & Kraus, 1994) haben ergeben, dass Empathie erblich
bedingt ist. Obwohl es individuelle Unterschiede gibt, scheinen die Menschen
schon von Natur aus Empathie zu besitzen und alle Kulturen kennen das Prinzip
der Wechselseitigkeit in einer gewissen Form (Moghaddam et al., 1993).
Trivers verwendete 1971 den Begriff „reciprocal
altruism“, um eine genetische Tendenz von gegenseitigem Helfen zu
bezeichnen; das erhöht die „inclusiv fitness“- die Wahrscheinlichkeit, dass ein
bzw. dieses Gen in die nächste Generation übertragen wird. Eine wichtige
Komponente von inklusiver Fitness ist eine Form des Helfens – die „kin selection“.
Kin selection ist ein sehr gut dokumentiertes Phänomen unter Tieren, das auf
die strenge, positive Assoziation zwischen biologischer Beziehung bzw.
Verbundenheit und gegenseitigem Helfen verweist (Alcock, 1989). Kin selection
macht entwicklungsgemäß Sinn, weil die Sicherung der Leben von Verwandten das
Auftreten des eigenen Gens in (nach-)folgenden Generationen erhöhen kann (Buss
& Kenrick, 1998). 1985/1986 rezensierte Cunningham die Untersuchung von
„kin selection“ und „reciprocal altruism“ bei Menschen und fand – die
biologische Perspektive unterstützend, dass bei näherer
Verwandtschaftsbeziehung die Erwartungen, dass Hilfe gegeben wird, größer sind
und
- umso
größer ist auch die Verstimmung bzw. Abneigung und der Ärger darüber, wenn
Hilfe zurückgehalten wurde und
- umso
größer ist ebenso die Bereitschaft den anderen Personen Hilfe und
Unterstützung anzubieten und
- umso
höher ist aber auch ihre Erwartung, dass die Hilfe erwidert werde.
Burnstein, Crandall und Kitayama (1994)
fanden heraus - übereinstimmend mit der Auffassung von kin selection, dass die
biologische Beziehung eine viel größere Auswirkung bzw. Bedeutung auf
lebenssichernde Hilfe hat. Diese wurde reduziert oder eliminiert, wenn es
unwahrscheinlich war, dass der empfängliche Verwandte Nachkommen produzieren
werde.
1990 verwendete Simon Literatur von der
Evolutionstheorie, Verhaltensgenetik und ökonomischen Theorie um ein Modell zu
entwickeln, das über „kin selection“ und „reciprocal altruismus“ berichtet.
Simon legt dar, dass altruistische Menschen mehr für das Wohl aller beitragen
als selbstbezogene Personen, und dass sie mehr geschätzt werden und mehr
Unterstützung bzw. Gewinne erhalten.
Daraus ergibt sich, dass sie eher
überleben und ihre altruistisch-genetische Erbanlage an die Nachkommen
weitergeben. Vergleichsweise zeigen ein- und zweieiige Zwillinge eine
genetische Basis für Altruismus. Es wurde weiters bewiesen, dass eineiige
Zwillinge besser miteinander kooperieren (Segal, 1993).
Zum Beispiel präsentierte Segal (1994)
ein- und zweieiigen Zwillingen eine Puzzleaufgabe. Eineiige Zwillinge zeigten
eine viel bessere Kooperation bei dieser Aufgabe; eine höhere Proportion von
erfolgreichen Endprodukten und vermehrtes Gleichsetzen der Puzzleteile. In
einer weiteren Studie von Segal (1991) mit Gefangenen-Dilemma-Spielen zeigte
sich, dass eineiige Zwillinge mehr kooperative Strategien wählten.
Zusammengefasst ist der Grund, warum
Menschen einander helfen, kognitiv und affektiv beeinflusst. Kognitiv deshalb,
weil Menschen lernen, dass Helfen ein positives, wertvolles, soziales Verhalten
ist und wann Hilfe passend und sinnvoll erscheint. Affektive Beeinflussung aus
dem Grund, da das Leid einer anderen Person im anderen empathische Erregung
auslösen kann. In Abhängigkeit davon, wie die eben genannte Erregung interpretiert
wird, kann eine Intervention gehemmt, egoistisches Helfen unterstützt oder
altruistische Motivation produziert werden.
Viele Modelle betonen, dass die
affektiven und kognitiven Prozesse nicht unabhängig zu betrachten sind.
Vielmehr können individuelle, entwicklungsgemäße und kulturelle Unterschiede
bei beiden Prozessen eintreten (Fiske, 1991).
4. Wer hilft?
4.1 Unterschiede in der Veranlagung
Die Tendenz sich an hilfsbereiten und
altruistischen Handlungen zu beteiligen ist ein Kennwert für eine prosoziale
Veranlagung. Es werden im folgenden 3 individuelle Aspekte betrachtet:
- demographische Unterschiede,
- persönliche Motive und
- sogenannten
Traits (Charaktereigenschaften).
Vor 70 Jahren war durch Untersuchungen
von Hartshorne und May (1928) die Meinung verbreitet, dass soziales Verhalten
weniger von überdauernden Persönlichkeitscharaketeristiken bestimmt wird, sondern mehr von der Situation
in welcher sich das Individuum gerade befindet. Diese Untersuchungen führten zu
der Meinung, dass sich soziales und altruistisches Verhalten nicht oder nur
schlecht vorhersagen lässt.
Auch in den 70er Jahren führten
Untersuchungen zu dem Schluss, dass die Suche nach einem allgemeinen
Persönlichkeitsmerkmal „altruistisch“ aussichtslos ist. (Dovidio, 1984)
Ein Grund für diese Ergebnisse könnte die
verwendete Untersuchungsmethode, das so genannte „Zuschauer-Paradigma“ gewesen sein.
Welches in einer Situation „Helfen“ oder „Nicht-Helfen misst“. Um eine Aussage
über eine Persönlichkeitseigenschaft zu treffen, müsste die Testperson jedoch
über längere Zeit in mehreren Situationen beobachtet werden. Je stärker die
situationsbezogenen Hinweisreize sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass
Veranlagungen zum tragen kommen (Penner, 1983).
In den letzten Jahren gelang es der
Forschung die Ursachen für soziales Verhalten durch das Zusammenwirken von
situationsbezogenen Faktoren auf der einen Seite und Veranlagung auf der
anderen Seite zu erklären. Sie wird als interaktionistische Perspektive
auf soziales Verhalten verstanden. Die auf Basis des erwähnten Ansatzes
durchgeführten Studien weisen auf eine viel größere Rolle für die Veranlagungen
hin als bisher angenommen wurde.
4.11
Demographische Aspekte
Demographische
Daten geben Informationen über den physischen und sozialen Status einer Person.
Verbindungen
von demographischen Daten und sozialen Handlungen sind Alter, ethnische
Herkunft, sozioökonomischer Status, Religion und Geschlecht.
Die
meisten Untersuchungen zu diesem Thema betreffen die Spendenfreudigkeit und die
ehrenamtliche Unterstützung von Organisationen, welche sich in sozialen
Bereichen betätigen.
Die in
diesen Untersuchungen gewonnen Daten werden in ihrer Gültigkeit auf der einen
Seite dadurch eingeschränkt, dass man aus ihnen keine kausalen Beziehungen
ableiten kann und auf der anderen Seite dadurch, dass es sich ausschließlich um
Daten aus den USA handelt.
Die
Ergebnisse zeigten dass die Spendenfreudigkeit mit dem Alter einer Person
zunimmt und ihren Höhepunkt mit einem Alter von 50 bis 60 Jahren erreicht
(Independont Sector, 1997).
Diese
Ergebnisse sind dadurch zu erklären, dass Menschen in diesem Alter über das
meiste Geld verfügen.
Es ergab
sich ein positiver Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und
Spendenfreudigkeit (Independent Sector, 1997), was weiters auch verständlich
macht, wieso die afroamerikanische Bevölkerung und die Gruppe der Hispanics
weniger Geld und Zeit in Gemeinnützige Organisationen investieren als
europäische Amerikaner. Eine Erklärung dieser Ergebnisse ist der höhere
Prozentanteil dieser Bevölkerungsgruppen in gesellschaftlich niedrigeren
Schichten (Schröder et al., 1995).
Diese
Resultate sind jedoch nicht nur auf Wohlstand zurück zu führen, denn auch der
Grad der Bildung korreliert positiv mit sozialem Verhalten. In den USA sind
Blutspender beinahe ausschließlich Menschen mit mindestens einem
Collegeabschluss (Piliavin & Callero, 1991).
Ein
weiterer Grund für den größeren Anteil an „Altruisten“ in höheren
Gesellschaftsschichten ist eine gewisse „innere Leere“ dieser Menschen: Jemand,
der materiell seine Ziele erreicht hat, versucht für sich durch soziale
Tätigkeiten neue Ziele zu ergründen.
Sowohl
Spendenfreudigkeit als auch ehrenamtliche Arbeit korrelieren positiv mit
Religiosität (Independent Sector, 1997). Ein Indikator dafür ist die Tatsache,
dass die Kirchen in den USA die größten Empfänger von Spenden sind (Galper,
1998).
4.12 Geschlechterunterschied
Obwohl
Untersuchungen zeigten, dass Frauen sich eher an ehrenamtlichen Tätigkeiten
beteiligen als Männer (Independent Sector, 1997), belegen andere Studien, dass
Männer mit größerer Wahrscheinlichkeit helfen als Frauen. Da diese Ergebnisse äußerst kontroversiell
anmuten, schließen Eagly und Crowly (1986) nicht auf Unterschiede in der
quantitativen Menge der erbrachten Hilfeleistung, sondern auf die
unterschiedliche Art der Hilfestellung.
Ob eine
Frau oder ein Mann Hilfe leistet, ist unter anderem davon abhängig, ob die
Situation konsistent bzw. inkonsistent in Bezug auf die jeweilige
Geschlechterrolle ist.
Die weibliche
Geschlechterrolle ist mit Attributen wie fürsorglich, gefühlsbetont und
einfühlsam verbunden (Ashmore, DelBoca,
& Wohlers, 1986).
Obwohl
beide, Männer und Frauen, bei der Beobachtung von Not eine physiologische
Erregung verspüren, ist es bei Frauen wahrscheinlicher, dass sie diese Erregung
als eine positive einfühlende Reaktion auf die Not der beobachteten Personen
interpretiert.
Gemäß
diesen Ergebnissen, leisten Frauen eher Hilfe in Form von persönlichen
Ratschlägen oder emotionaler Unterstützung (Eagly & Crowly, 1986; Eisenberg
& Fabes, 1991).
Die
männliche Geschlechterrolle korreliert höher mit Kraft, verstanden als
unabhängig und bestimmend (Ashmore et al. 1986). Männer werden daher eher in
Situationen Hilfe leisten, in denen ihr Verhalten als heroisch interpretiert werden kann (Eagly
& Crowly, 1986).
Es ist
auch wahrscheinlich, dass Geschlechterrollen die Vorstellung von Kosten und
Nutzen einer Hilfestellung beeinflussen. Der Aufwand für „liebevolle“
Hilfestellungen ist für Frauen geringer als die Kosten für die Unterlassung
dieses Verhaltens.
Die
Autoren bringen das Beispiel eines Freundes der um seelischen Beistand bittet.
Die Unterlassung dieser Hilfestellung schmerzt Frauen mehr als Männer.
Analog
dazu sehen Männer die Kosten für ein Versagen bei heroischer Hilfestellung
größer als Frauen und die Kosten einer derartigen Form der Hilfe als niedriger
(Eagly & Crowly, 1986).
4.13
Motive und Hilfestellung
Menschen
unterscheiden sich vielleicht auch auf Grund ihrer persönlichen Ziele, welche
für das Helfen verantwortlich sind (Clary & Snyder, 1991; Clary et
al.,1991). Aufgrund dieser Idee wurde eine funktionelle Analyse durchgeführt,
mit der Absicht Gründe für soziales Verhalten, welches lange Zeit hindurch
bestehen bleibt, zu finden.
Aufgrund der Ergebnisse dieser
Untersuchungen wurden 6 „primary needs“, also Motive, gefunden welche
die Teilnahme an ehrenamtlichen Tätigkeiten erklären soll (Clary et al., 1998;
Clary & Snyder, 1991).
„Primary needs“ sind:
1. Wertebetont: Man will Werte zum Ausdruck bringen
welche in einem alt-
ruistischen
Kontext stehen
2. Verständnis: Wissens- und Fähigkeitserwerb steht im
Vordergrund
3. Sozial: Der Kontakt mit Freunden und Aufmerksamkeit für die eigene
Person
4. Karriere: Man praktiziert ein Verhalten, welches
einem im Beruf voran bringt.
5. Schutz: Der Schutz des eigenen Ego´s vor negativen
Charaktereigenschaften
6. Steigerung: persönliche Entwicklung und
Selbstwertsteigerung
In Bezug
zu diesen Ergebnissen ist zu sagen, dass verschiedene Menschen verschiedene
Gründe haben zu helfen (Allen und Rushton, 1983; Independent Sector, 1997).
Untersuchungen zeigten, dass das häufigste Motiv das „wertebetonte“ ist,
welches das Wohlergehen des Anderen zum Inhalt hat. Es wurden jedoch auch mehr
egoistische Motive gefunden. Als Beispiel hierfür sei die Steuererleichterung
beim Spenden erwähnt (Independent Sector, 1997).
In einer
Studie über die Gründe für ehrenamtliche Tätigkeit in AIDS- Beratungsstellen
stieß man auf die Motive Verständnis, Selbstwertsteigerung und persönliche
Entwicklung (Omto & Snyder, 1995).
Es wurden
auch noch andere Motive als die sechs oben erwähnten gefunden. Unter männlichen
ehrenamtlichen Mitarbeitern bei AIDS-Hilfe Organisationen wurden positive
Korrelationen zwischen Wertebetonung und der Bindung zu der jeweiligen
Organisation festgestellt (Penner & Finkelstein, 1998).
Außerdem
wurde festgestellt, dass Menschen, welche an Konfliktlösungsprogrammen für
Gefangene teilnehmen, die oben erwähnte Wertebetonung als Motiv angeben (Deux & Stark, 1996).
4.14
Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Altruismus
Graziano und Eisenberg (1997) haben 3
verschiedene Beweise gefunden, dass die Unterschiede im prosozialen Verhalten
zum Teil auf Traits zurückzuführen sind.
Diese 3 Beweise sagen aus, dass:
- Unterschiede im sozialen Verhalten vererbt sind,
- Prosoziales Verhalten über die Zeit stabil ist und
- Persönlichkeitseigenschaften, welche mit Altruismus assoziiert werden, eine Entsprechung
im sozialen Verhalten haben.
Individuelle Unterschiede im Abwägen
zwischen Kosten und Nutzen eines sozialen Verhaltens, finden ihre
Entsprechungen auf der Persönlichkeitsebene in kognitiven Prozessen wieder.
Als Beispiel sei hierfür die Neigung
angegeben, in wieweit ein Individuum die Verantwortung für das Helfen übernimmt,
diese Eigenschaft wurde als wichtige Persönlichkeitseigenschaft identifiziert
(Schwarz & Howard, 1982)
In anderen Untersuchungen wurde diese
Persönlichkeitseigenschaft auch zur Unterscheidung von Rettern bzw.
Nicht-Rettern der Juden in der Nazi Zeit verwendet.
Auch Untersuchungen zur medizinischen
Hilfe und zur Zivilcourage ergaben eine positive Korrelation zwischen
Verantwortungsbewusstsein und Helfen. Das Selbstvertrauen und Gefühle der
Sicherheit, welche auch zur Abschätzung der Kosten und Nutzen bzw. der
Sicherheit in einer Situation adäquat zu helfen beitragen, sind auch
Persönlichkeitskorrelate, welche mit Altruismus in Verbindung stehen (Graziano
& Eisenberg, 1997).
Als Beispiel wird das größere
Selbstbewusstsein der Helfer im Gegensatz zu den Nicht-Helfern angegeben.
Nach Colby und Damon sind die wichtigsten
Eigenschaften der 22 lebenslangen Altruisten, welche sie interviewt haben, die
Zuversicht Ziele und Aufgaben zu meistern und die Tendenz sich nicht entmutigen
zu lassen. Das bedeutet es waren Individuen mit einer hohen Selbstsicherheit.
Ein stärkerer Beweis für das
Zusammenwirken von Persönlichkeitseigenschaften und dem Abschätzten von Kosten
und Nutzen kommt von Penner (Penner, Fritzsche, & Craiger, 1995). Sie
entwickelten einen Test für die Prosoziale Neigung eines Menschen, den „Prosocial
Personality Battery“.
Einer der beiden Faktoren wird
Helpfulness genannt. Er korreliert mit einer hohen Anzahl an helfenden
Handlungen, darunter ist die Hilfe in Notfällen, aber auch die Hilfe für Freunde
ohne den Hintergrund eines Notfalles. Auch Ehrenamtlichkeit oder gewerkschaftliche
Aktivitäten in Unternehmen zählen dazu. (Penner & Finkelstein, 1998, Penner
et al., 1995). Dieser Test korreliert negativ mit der Veranschlagung von Kosten
für das Helfen. (Penner et al., 1995)
Andere Persönlichkeitseigenschaften,
welche mit Helfen assoziiert werden, sind direkt oder indirekt mit Erregung
verbunden. Einfühlungsvermögen ist eine der wichtigsten dieser
Persönlichkeitsmerkmale. Affektive Empathie beinhaltet die Tendenz, Gefühle und
Emotionen als Antwort auf Gefühle von Anderen zu zeigen. Unter kognitiver
Empathie versteht man die Fähigkeit, Dinge aus der Perspektive einer anderen
Person zu sehen (Davis, 1994).
Zum Beispiel entdeckten Oliner und Oliner
(1988), dass Empathie als Charaktereigenschaft Retter von Nicht-Rettern der
Juden in der Nationalsozialistischen-Zeit unterscheidet.
Als weniger dramatisches Beispiel gibt
Davis (1983) die positive Korrelation von Empathie und Menge an gespendetem
Geld an. Die Ergebnisse von Otten, Penner und Altabe (1991) ergaben auch unter
professionellen Helfern, Psychotherapeuten, eine positive Assoziation von
selbstberichteter dispositionaler Empathie.
Persönlichkeitstests betrachten auch
Eigenschaften, welche stark ineinander verschachtelte kognitive wie affektiven
Faktoren repräsentieren. Penners Untersuchungen (Penner & Craig, 1991)
ergaben, dass Empathie, soziales Verantwortungsgefühl und das Achten auf das
Wohl des Anderen miteinander stark verbunden sind. Der zweite Faktor ihres
Persönlichkeitstest heißt deshalb auch „Other-Oriented-Empathy“.
Er bezieht sich auf die Tendenz
einfühlsam zu sein, sich um das Wohl des Anderen zu sorgen und soziales
Verantwortungsgefühl zu zeigen, mit anderen Worten prosoziale Gedanken und
Gefühle.
Scores in diesem Faktor korrelieren mit
der Abschätzung von Kosten und mit gefühlsbetonten Reaktionen auf Leid und
Kummer anderer.
Der „Other-Oriented-Empathy“- Faktor ist
mit einer großen Anzahl prosozialer Handlungen in Notsituationen sowie in
Nicht-Notsituationen verbunden und beinhaltet offizielle wie inoffizielle Arten
der Hilfestellung. Die Messung von Hilfsbereitschaft beinhaltet die
Wahrscheinlichkeit und Geschwindigkeit mit welcher eine Person in einer
Notsituation Hilfe leistet (Harter, personal communication, 8.04.1997), die
Bereitschaft für die Teilnahme an ehrenamtlichen Tätigkeiten (Sibicky, Mader,
Redshaw und Cheadle, 1994), die aktuelle Teilnahme an ehrenamtlichen
Tätigkeiten (Penner & Fritzsche, 1993), die Länge einer freiwilligen
Tätigkeit (Penner & Fritzsche, 1993)
4.2 Persönlichkeit und Helfen: Kritik
Bevor man die Diskussion um die
Veranlagung von sozialem Verhalten abschließt, müssen noch einige Einwände
eingebracht werden.
Erstens: Ein umfassendes Verständnis vom Helfen
beinhaltet nicht nur Persönlichkeitsfaktoren an sich, sondern auch das Wissen
um die Interaktion von spezifischen Traits.
Zweitens: Obwohl Persönlichkeit als ein wichtiger
Faktor beim Helfen aufgefasst wird, spielen Persönlichkeitsfaktoren eine geringere
Rolle als situationsbezogene Faktoren. (Oliner & Oliner, 1988)
Drittens: In vielen Studien sind kausale Schlüsse
schwierig. So sind ehrenamtlichen Tätigkeiten eher für eine Prägung als
verantwortungsbewusster, einfühlsamer Mensch verantwortlich als das Helfen an
sich.
Letztlich müssen Persönlichkeitsstudien
mehr auf die Mechanismen eingehen, welche zwischen spezifischen
Persönlichkeitseigenschaften und altruistischem Verhalten vermitteln.
Menschen helfen nicht, weil sie in einem
Test hohe Ergebnisse in Empathie erreichen, sondern weil ihre Tendenz zu
empathischen Verhalten eine gewisse gefühlsbetonte bzw. kognitive Reaktion
auslöst, welche dann das prosoziale Verhalten auslöst.
5. Anwendungsgebiete
5.1
Zivilcourage
Zivilcourage wird im Fremdwörterbuch
Duden als „mutiges Verhalten, mit dem
jemand seinen Unmut über etwas ohne Rücksicht auf mögliche Nachteile gegenüber
Obrigkeiten, Vorgesetzten oder ähnlichen zum Ausdruck bringt“ definiert.
(Duden, 2005, s. v. Zivilcourage).
Sie ist ein selbstgesteuertes Verhalten, das nicht durch Aufforderung
veranlasst wird, daher fällt sie mit einer höheren internalen
Kontrollüberzeugung zusammen.
Über die Entstehung von Zivilcourage weiß
man mehr, da es eine Studie von Bürgerrechtsaktivisten aus den USA gibt, die in
den sechziger Jahren für das Wahlrecht der Schwarzen und ihre Berechtigung
gekämpft haben (Rosenhan, 1970). Die Befragung ergab, dass Aktivisten von ihren
Eltern berichteten, dass sie ebenfalls liberale Einstellungen hatten und sich
gleichfalls aktiv für deren Verwirklichung eingesetzt hatten. Gelegentliche
Aktivisten waren dadurch gekennzeichnet, dass eine Glaubwürdigkeitslücke in der
Sozialisation auftrat, da die Eltern zwar liberale Einstellungen vertreten
hatten, aber jedoch niemals so gehandelt haben. In diesem Zusammenhang spricht
man von der Krise der Heuchelei, die Zivilcourage unwahrscheinlich macht.
Ergebnisse von Clary und Miller (1986)
bestätigen die Ergebnisse in Bezug auf ehrenamtliche Tätigkeit. Das Vorbild der
Eltern wirkte sich also positiv auf die Bindung an Hilfsorganisationen aus.
5.2
Theorie der intrinsischen Motivation und freiwilliges
Arbeitsengagement
Freiwilliges Arbeitsengagement bezieht sich auf prosoziales Verhalten in
Unternehmen, das für die Kooperation unter den Mitarbeitern von Bedeutung ist.
Freiwilliges Arbeitsengagement kann von keiner höher gestellten Person verlangt
werden. Das Besondere daran ist, dass es auf einer selbstbestimmten
Eigenmotivation beruht (Rohmann, Bierhoff, & Müller, 2000). Engagement ist bei jenen Mitarbeitern höher
ausgeprägt, die über eine größere intrinsische Arbeitsmotivation verfügen
(Bierhoff, Müller, & Küpper, 2000), welche durch eine interessante und
herausfordernde Arbeit angeregt wird. Auch sind hohe Zufriedenheit, hohe
Fairness und positive Stimmung am Arbeitsplatz, sowie höhere Bildung,
Vorbildwirkung durch prosoziales Verhalten der Vorgesetzten und deren
unterstützendes Führungsverhalten Faktoren für ein hohes Arbeitsengagement.
Ein solcher motivierender Führungsstil
wird in dem Prinzipienmodell der Führung dargestellt, das verschiedene
Prinzipien enthält, deren Verwirklichung zur Steigerung des Engagements der
Mitarbeiter beitragen kann (Frey, Brodbeck, & Schulz-Hart, 1999).
Wichtig im Zusammenhang ist das Prinzip
der Autonomie und Partizipation. Die Förderung der intrinsischen Motivation
durch Schaffung von Autonomiespielräumen und mehr Mitspracherecht ist eine
wichtige Zielsetzung einer erfolgreichen Führung.
5.3
Attributionstheorie und prosoziales Verhalten in der Schule
Weiner (1980) erkannte schon früh die
wichtige Rolle der Attributionstheorie für hilfreiches Verhalten.
Beispiel: Ein Studierender benötigt
dringend Vorlesungsaufzeichnungen und bittet nun Mitstudierende um ihre
Aufzeichnungen. Wenn die Entstehung dieser Notlage mit Fehlverhalten erklärt
wird (z.B. ein Studierender ist einfach faul), ist die Hilfsbereitschaft
geringer als wenn der Studierende unverschuldet in eine Notlage gekommen ist
(z.B. durch Krankheit). Im zweiten Fall wird die Ursache als unkontrollierbar
eingestuft und somit kommt eine gewisse Sympathie zu dieser Person auf, und
eine Bereitschaft zur Hilfeleistung entsteht.
Attribution spielt aber noch eine
umfassendere Rolle, wie sich anhand der Sozialisation von Hilfeleistung in der
Schule zeigen lässt (Bierhoff, 1998).
Ähnlich wie beim freiwilligen
Arbeitengagement lässt sich feststellen, das ein soziales Verhalten in der
Schule nur bedingt durch Belohnungspläne, die auf positive Verstärkung der
Hilfsbereitschaft hinauslaufen, fördern lässt, denn mit der Zeit wird das
prosoziale Verhalten von der Belohnungserwartung abhängig gemacht.
Den Schülern kann durch Attributionen der
Eindruck vermittelt werden, dass sie einen prosozialen Charakter besitzen, der
eine Bereitschaft zu sozialem Verhalten mit sich bringt. Solche
Attributionsstrategien können bei Kindern die Hilfsbereitschaft erhöhen und
stabilisieren (Grusec & Redler, 1980). Wichtig ist, dass Kinder und
Jugendliche die soziale Identität einer hilfsbereiten Person erwerben.
6. Fazit
Wie lässt sich der gegenwärtige Stand der
Theoriebildung zum hilfreichen Verhalten beurteilen? Wo liegen die Stärken und
Schwächen?
Positiv ist zu bemerken, das Empathie und soziale Verantwortung umfassend
untersucht wurden, und sowohl die Gründe für Hilfeleistung, als auch großteils
die Gründe für das Unterlassen von Hilfe weitgehend geklärt sind. Weiterhin
erweist sich, dass die Ergebnisse eine bedeutsame Anwendungsperspektive
aufweisen, die speziell den schulischen und beruflichen Bereich betrifft.
Zu kritisieren ist, dass die theoretische
Auseinandersetzung um die Frage ob es ein eigenständiges altruistisches
Motivsystem neben dem egoistischen Motivsystem gibt, in eine Sackgasse geführt
hat, da eine abschließende Antwort nicht zu erwarten ist (vgl. Batson et al.,
1997). Gleichzeitig wird deutlich, dass Hilfe häufig unterlassen wird, wenn
z.B. die Angst sich zu blamieren besteht.
Zukünftige Forschung kann sich verstärkt
der Frage des Zusammenspiels egoistischer und altruistischer Motive und ihrer
Veränderung über die Zeit zuwenden.